News
25.02.2020 | permalink
Agrochemiekonzerne verdienen Milliarden mit hochtoxischen Pestiziden

Die großen Agrochemiehersteller machen mehr als ein Drittel ihres Hauptumsatzes mit Pestiziden, die für Mensch, Umwelt und Bienen hochgiftig sind – und dies vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern und häufig mit Substanzen, die in Europa schon längst vom Markt genommen wurden. Das geht aus einer Studie hervor, die von der Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye und der zu Greenpeace UK gehörenden Rechercheabteilung „Unearthed“ am 20. Februar vorgelegt wurde. Sie stützt sich auf Daten der auf die Branche spezialisierten Firma Phillips McDougall und nimmt die fünf Chemieriesen BASF, Bayer Crop Science, Corteva Agriscience, FMC und Syngenta unter die Lupe, die zusammen über 65% des globalen Pestizidmarktes kontrollieren. Dieser wird für 2018 auf 57,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und die fünf Konzerne setzten davon insgesamt 23,3 Milliarden US-Dollar um – da der Datensatz somit nur etwa 40% der weltweiten Agrochemie-Verkäufe umfasst, handle es sich um „äußerst konservative Schätzungen“, wie die Herausgeber betonen. Die Umsatzdaten wurden mit der Schwarzen Liste des internationalen Pestizid Aktions-Netzwerks (PAN) abgeglichen, die Risikobewertungen von Behörden und anerkannten Institutionen zusammenführt.
Die Resultate der Analyse zeigen, dass die fünf Unternehmen 2018 mit ihren Bestsellern und auf den größten Märkten gemeinsam 13,4 Milliarden US-Dollar Umsatz machen. 35% dieser Pestizidumsätze oder 4,8 Milliarden US-Dollar weltweit machten sie mit Substanzen, die als hochgefährliche Pestizide (HHPs) eingestuft werden und Mensch und Umwelt schaden. In Ländern mit mittleren oder niedrigen Einkommen machten hochgefährliche Pestizide etwa die Hälfte des Umsatzes aus. Davon entfallen 3 Milliarden oder 22% am Gesamtumsatz auf chronisch toxische Produkte, die sich langfristig auf die menschliche Gesundheit negativ auswirken können. An der Spitze der Liste stehen Stoffe, die als „für Menschen wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft sind und 2018 rund 13% des Gesamtumsatzes der fünf Konzerne ausmachten, sowie Substanzen, die das Fortpflanzungssystem und die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen können, wie etwa Chlorothalonil und Chlorpyrifos.
Zudem erzielten die fünf Konzerne 4% ihrer Umsätze oder etwa 600 Millionen US-Dollar mit Pestiziden, die für Menschen akut giftig sind. Diese hochtoxischen Pestizide verursachen jährlich rund 25 Millionen Fälle akuter Vergiftungen, der Löwenanteil in Entwicklungsländern, wovon 220.000 Fälle tödlich enden. Diese Zahlen stammen aus dem Jahr 1990 – da der Pestizideinsatz in Entwicklungsländern in den letzten 30 Jahren explosionsartig zugenommen hat, schätzen Experten die aktuelle Zahl der Vergiftungen höher ein. Die meistverkaufte Substanz ist ein Insektizid von Syngenta, Lambda-Cyhalothrin, das von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) als „tödlich bei Einatmung“ eingestuft wird, aber auch noch in der EU zugelassen ist. An zweiter Stelle folgt Paraquat, ein Herbizid, das wegen seiner „hohen akuten Toxizität“ in der EU 2007 vom Markt genommen wurde.
Die fünf Konzerne generierten 2018 zudem 10% ihrer Hauptumsätze oder etwa 1,3 Milliarden US-Dollar mit Stoffen, die für Bienen hochgiftig sind; darunter Neonikotinoide, die mitverantwortlich für den globalen Rückgang vieler Bestäuber gemacht werden. Syngenta ist mit fast der Hälfte dieser Verkäufe führend. Die Verkaufsschlager in dieser Kategorie sind Thiamethoxam von Syngenta und Imidacloprid von Bayer, zwei Neonikotinoide, die nach einem langen Rechtsstreit 2018 von EU-Äckern verbannt wurden. Der Studie zufolge verkauften die Konzerne 37 weitere Pestizide, die als hochgiftig für Bestäuber gelten. „Es ist beschämend, wie sich die chemische Industrie den Diskurs der nachhaltigen Entwicklung aneignet, während sie gleichzeitig ein alles andere als nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgt“, kritisiert Baskut Tuncak, UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und toxische Substanzen.
Die Analyse zeigt auch, dass die Konzerne in Entwicklungs- und Schwellenländer fast 60% ihrer Verkäufe mit hochgefährlichen Pestiziden erzielen. Die Konzerne nutzen schwache Regulierungen in Ländern wie Brasilien oder Indien, um dort weiterhin Produkte verkaufen zu können, die in der EU bereits verboten sind. „Wenn ein Pestizid in Europa gefährlich ist, dann wird es nicht auf wundersame Weise sicherer in Indonesien oder in Angola, wo diese Pestizide dann hingehen“, sagte Tuncak im Interview mit dem Magazin Monitor, das über die Studie berichtete. „Die Firmen sollten sich schämen, dass sie weiterhin behaupten, sie seien nachhaltig, während sie derart unethisch und unmoralisch handeln.“ Die verantwortungslose Praxis der Agrochemiekonzerne sei ein Verrat gegenüber ihren eigenen Versprechen, sich für eine nachhaltigere Landwirtschaft einsetzen zu wollen. Er und die Herausgeber der Studie fordern verbindliche Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Pestizidkonzerne weltweit die Menschenrechte achten und Umweltschäden vermeiden. „Wir wissen, dass freiwillige Vereinbarungen auf internationaler Eben nicht wirken. Für hochgefährliche Pestizide haben sie seit Jahren nicht gewirkt“, so Tuncak. (ab)
19.02.2020 | permalink
Studie: Gesundheit und Wohlergehen von Kindern weltweit in Gefahr

Die Gesundheit und Zukunft von Kindern weltweit ist akut bedroht durch den Klimawandel, Umweltzerstörung, Migration und Konflikte, wirtschaftliche Ungleichheit sowie aggressive Marketingpraktiken für ungesunde Lebensmittel. Dies ist die traurige Botschaft der Studie „A Future for the World’s Children?“, die vom Kinderhilfswerk UNICEF, der Weltgesundheitsorganisation und dem Fachjournal Lancet beauftragt wurde. Die Kommission von 40 internationalen Experten für Kindergesundheit gelangt zu dem Schluss, dass nicht ein einziges Land die Gesundheit der Kinder, ihre Umwelt und ihre Zukunft angemessen schützt. „Trotz Verbesserungen bei der gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen in den letzten 20 Jahren sind Fortschritte ins Stocken geraten oder drohen rückgängig gemacht zu werden“, so Helen Clark, ehemalige Premierministerin von Neuseeland und Ko-Vorsitzende der Kommission. „Schätzungen zufolge laufen etwa 250 Millionen Kinder unter fünf Jahren in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen Gefahr, ihr Entwicklungspotenzial nicht zu erreichen, wenn man Zahlen zu chronischer Mangelernährung und Armut zugrunde legt. Noch besorgniserregender ist jedoch, dass jedes Kind weltweit durch den Klimawandel und schädliche kommerzielle Werbung existentiell bedroht ist“, fügte sie hinzu.
Der Bericht enthält einen neuen globalen Index, der Daten von 180 Ländern zur Gesundheit und zum Wohlergehen von Kindern sowie zu Nachhaltigkeit und Chancengleichheit zusammenfasst. Die Autoren stellen fest, dass die ärmsten Länder mehr tun müssen, um Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen, während die Industrieländer durch den überproportional von ihnen verursachten CO2-Ausstoß die Zukunft und die Gesundheit aller Kinder weltweit bedrohen. Dem Index zufolge haben Kinder in Norwegen, der Republik Korea, den Niederlanden, Frankreich und Irland die besten Chancen, zu überleben und sich wohlzufühlen. Am unteren Ende der Skala befinden sich Länder mit niedrigem Einkommen, wie die Zentralafrikanische Republik, der Tschad und Somalia, die sowohl beim Überleben als auch beim Wohlergehen der Kinder schlecht abschneiden.
Werden die CO2-Emissionen pro Kopf einbezogen, ändert sich das Bild: Dann befindet sich Norwegen abgeschlagen auf Platz 156, Korea auf Platz 166 und die Niederlande auf Platz 160. Diese drei Länder stoßen 210% mehr CO2 pro Kopf aus, als ihr Ziel für 2030 zulässt. Die USA, Australien und Saudi-Arabien gehören zu den zehn schlimmsten CO2-Emittenten. Wenn die Erderwärmung bis 2100 die 4°C-Marke übersteigt, wie es Szenarien annehmen, die von einem Weiter-wie-bisher ausgehen, hätte dies verheerende gesundheitliche Folgen für Kinder. Ursachen wären die Überflutung von Küstenstädten und kleinen Inselstaaten, die erhöhte Sterblichkeit durch Hitzewellen, die Verbreitung von Krankheiten wie Malaria und Dengue sowie Unterernährung durch die Beeinträchtigung der Lebensmittelproduktion. Die einzigen Länder, die auf einem guten Weg sind, um die anvisierten Ziele beim CO2-Ausstoß pro Kopf zu erreichen und die auch beim Wohlergehen der Kinder recht gut abschneiden (unter den Top 70), sind Albanien, Armenien, Grenada, Jordanien, Moldawien, Sri Lanka, Tunesien, Uruguay und Vietnam.
Der Bericht zeigt auch die schwerwiegenden Folgen auf, die schädliche Werbe- und Marketingpraktiken für die Gesundheit der jungen Generation haben. „Unternehmen machen enorme Gewinne durch die direkte Vermarktung von Produkten an Kinder und die Förderung süchtig machender oder ungesunder Waren, einschließlich Fastfood, gezuckerten Getränken, Alkohol und Tabak, die alle als Hauptursache für nicht übertragbare Krankheiten gelten.“ So sehen Kinder in einigen Ländern jährlich über 30.000 Werbeanzeigen im Fernsehen. Es bestehe ein Zusammenhang zwischen dem Sehen von Werbung für ungesundes Essen und zuckerhaltige Getränke und dem Konsum ungesunder Lebensmittel, Übergewicht und Fettleibigkeit. Aggressives Marketing habe zum alarmierenden Anstieg der Fettleibigkeit bei Kindern beigetragen. Die Zahl fettleibiger Kinder und Jugendlicher hat sich von 11 Millionen im Jahr 1975 auf 124 Millionen in 2016 erhöht – um das Elffache. Die Autoren betonen, dass Selbstverpflichtungen der Industrie nicht funktionieren.
Die Kommission fordert ein radikales Umdenken in Sachen Kindergesundheit und liefert 10 Empfehlungen, wie die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen gefördert werden kann. Der CO2-Ausstoß müsse drastisch reduzieren werden, um den Planeten für künftige Generationen zu erhalten. Zudem seien neue politische Initiativen und verstärkte Investitionen in Kindergesundheit und die Umsetzung der Kinderrechte vonnöten. Die Experten raten dazu, schädliche Werbemaßnahmen auf nationaler Ebene strenger zu regulieren und die UN-Kinderrechtskonvention um ein neues Zusatzprotokoll zu ergänzen. „Klimawandel, Übergewicht und schädliche Werbe- und Marketingpraktiken führen dazu, dass Kinder Gefahren ausgesetzt sind, die vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar schienen“, sagte UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore. „Deshalb sind tiefgreifende Veränderungen nötig: Jede Regierung muss die Rechte von Kindern ins Zentrum ihrer Politik stellen und ihr Wohlergehen zum Maßstab ihres Handelns machen.“ (ab)
12.02.2020 | permalink
Öko-Anbaufläche wächst – in Deutschland und weltweit

Bio boomt weltweit wie nie zuvor: Rund um den Globus wurden 2018 mehr als 71,5 Millionen Hektar Land ökologisch bewirtschaftet – ein Anstieg um 3% gegenüber dem Vorjahr. Das zeigt der Bericht „The World of Organic Agriculture“, der vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und IFOAM – Organics International am Mittwoch auf der Messe BIOFACH präsentiert wurde. Ausgewertet wurden Daten zum Ökolandbau in 186 Ländern. Die Bioanbaufläche nahm demnach 2018 um 2 Millionen Hektar zu. Die Hälfte der ökologisch bewirtschafteten Fläche (36 Millionen Hektar) liegt aufgrund des Spitzenreiters Australien in Ozeanien, gefolgt von Europa mit 15,6 Millionen Hektar (22%) und Lateinamerika mit 8 Millionen Hektar (11%). Das Länder-Ranking führt Australien mit einer absoluten Bioanbaufläche von 35,7 Millionen Hektar an, danach kommen Argentinien und China mit 3,6 bzw. 3,1 Millionen Hektar.
Beim weltweiten Anteil des Ökolandbaus ist mit 1,5% noch deutlich Luft nach oben, doch einige Länder sind bereits sehr viel weiter: Liechtenstein liegt mit einem Bioanteil von 38,5% an der Gesamtfläche vorne – vor Samoa (34,5%) und Österreich (24,7%). Insgesamt gab es 16 Länder, die es 2018 auf einen Bioanteil von 10% oder mehr brachten. In Europa gehörten noch Estland, Schweden, Italien, Lettland, die Schweiz, Finnland und die Slowakei dazu. Weltweit gab es dem Bericht zufolge 2018 rund 2,8 Millionen Bioproduzenten. Davon sollen 1.149.000 in Indien, 210.000 in Uganda und 204.000 in Äthiopien leben. Der globale Markt für Bioprodukte wird für 2018 auf umgerechnet 97 Milliarden Euro geschätzt. Hier sind hier die USA führend mit einem Umsatz von 40,6 Milliarden Euro, gefolgt von Deutschland mit 10,9 und Frankreich mit 9,1 Milliarden Euro. Der französische Markt für Bioprodukte legte am stärksten zu mit einem Plus von 15%, während in Dänemark der Marktanteil der Bioprodukte mit 11,5% am höchsten ist.
Auch in Deutschland befindet sich der Ökolandbau im Aufwind, wie die aktuellen Zahlen des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) zeigen. Die deutsche Öko-Fläche vergrößerte sich 2019 um 107.000 Hektar auf 1.622.103 Hektar Biofläche – ein Zuwachs von 6,6% gegenüber 2018. In den letzten 5 Jahren legte die Bio-Fläche insgesamt um fast 50% zu. Mittlerweile wird hierzulande 10% der gesamten Landwirtschaftsfläche von Bio-Bauern beackert. „Jeder zehnte Hektar in Deutschland ist enkeltauglich“, sagte BÖLW-Geschäftsführer Peter Röhrig. „Auf jedem der insgesamt 1.622.103 Bio-Hektar schützen Öko-Landwirte Böden, Gewässer, Klima und Artenvielfalt.“ Die Zahl der Bio-Betriebe erhöhte sich im letzten Jahr auf 33.698 Betriebe, ein Plus von 6,3%. Damit wirtschaften 12,6% aller landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland ökologisch. Während in der Bundesrepublik seit 2005 im Schnitt jede Stunde ein Betrieb aufgab, hat sich im selben Zeitraum die Zahl der Bio-Höfe fast verdoppelt. „2019 stellten täglich durchschnittlich fünf Bauern ihren Betrieb auf ökologische Landwirtschaft um“, erläutert Röhrig.
Und auch die Nachfrage nach Bioprodukten steigt stetig. Der Markt mit Biolebensmitteln und -getränken verbuchte 2019 ein ordentliches Umsatzplus von 10% und erzielte ein Marktvolumen von rund 11,97 Milliarden Euro. „Immer mehr Menschen wollen unsere Bäuerinnen und Unternehmer stärken. Die Kunden und Kundinnen setzen sich mit dem Griff zu Bio für unser Klima, für Biene und Feldhase, die artgerechte Haltung von Kühen, Huhn und Co. und die Gesundheit ihrer Familien und der Umwelt ein“, kommentierte Röhrig die Zahlen. Der Lebensmitteleinzelhandel hat einen Anteil von 60% - die Kunden gaben dort 7,13 Milliarden Euro für Bioprodukte aus. Der Naturkosthandel kommt auf einen Marktanteil von 27%, der Rest entfällt auf sonstige Geschäfte.
„Damit auch neue Unternehmen die Bio-Chance nutzen können, müssen Bundesregierung und Länder den politischen Rahmen konsequent auf die auszurichten, die Gemeinwohlleistungen erbringen“, äußerte BÖLW-Vorsitzender Felix Prinz zu Löwenstein. Es komme darauf an, die komplette Wertschöpfungskette mitzudenken und zu stärken. Die Notwendigkeit, einen besseren Rahmen zu setzen, sieht er vor allem auch bei der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU. „Die EU-Agrarpolitik bestimmt mit Milliarden, welche Landwirtschaft sich lohnt. Wichtig ist, dass mindestens 70% der Agrargelder an freiwillige Umwelt-Leistungen gebunden werden“, so Löwenstein. Heimische Standards dürften nicht durch Handelsabkommen wie Mercosur ausgehebelt werden. „Nur wenn die Regierungen all diese Stellschrauben drehen, können Bundesministerin Julia Klöckner und ihren Kolleginnen und Kollegen in Bund und den Ländern das Ziel von Nachhaltigkeitsstrategie und GroKo-Koalitionsvertrag von 20 % Bio bis 2030 überhaupt erreichen“, betont der BÖLW-Vorsitzende. (ab)
05.02.2020 | permalink
Deutsche Fleischproduktion 2019 erneut leicht gesunken

Im letzten Jahr ist die Fleischerzeugung in Deutschland leicht auf knapp unter 8 Millionen Tonnen Fleisch gesunken. Das vermeldete das Statistische Bundesamt am Mittwoch. Demnach verringerte sich die gewerblich erzeugte Gesamtschlachtmenge gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent beziehungsweise von 8,07 auf 7,96 Millionen Tonnen. Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, in dem die deutsche Fleischproduktion nachlässt, nachdem 2016 mit 8,28 Millionen Tonnen Schlachtmenge noch ein Rekordwert erreicht wurde. Insgesamt mussten 55,1 Millionen Schweine und 3,4 Millionen Rinder in deutschen Schlachthöfen ihr Leben lassen.
Der Rückgang bei der Gesamtmenge ist vor allem einer geringeren Schweinefleischerzeugung geschuldet, während die Produktion von Rind- und Geflügelfleisch gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. 2019 wurde in Deutschland mit 5,2 Millionen Tonnen 2,6 % weniger Schweinefleisch erzeugt als noch im Vorjahr. Die Zahl der geschlachteten Schweine inländischer Herkunft ging um 3,4 % auf 51,8 Millionen Tiere zurück, während die Zahl der Schweine, die für die Schlachtung in die Bundesrepublik eingeführt wurden, auf 3,3 Millionen stieg – ein Plus von 2,7 Prozent. Beim Rindfleisch stieg die Schlachtmenge um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es wurden zwar etwas weniger Rinder geschlachtet als noch 2018, aber da das durchschnittliche Schlachtgewicht zunahm, erhöhte sich auch die Schlachtmenge auf 1,13 Millionen Tonnen Rindfleisch.
2019 wurde zudem etwas mehr Geflügel der Garaus gemacht als noch im Vorjahr. Die Schlachtmenge stieg um 0,8% auf 1,6 Millionen Tonnen. Die Tabellen und Grafiken des Statistischen Bundesamtes zeigen zudem auch eindrücklich den enormen Anstieg der Schlachtmenge beim Geflügel: In den letzten zehn Jahren ist die Geflügelfleischproduktion um 22% in die Höhe geschnellt. Für 2018 vermeldete das Amt 709.657.566 geschlachtete Hühnchen. Die produzierte Menge an Schweine- und Rindfleisch hingegen ist in den letzten zehn Jahren, abgesehen von leichten Schwankungen in einzelnen Jahren, in etwa auf dem gleichen Niveau geblieben. (ab)
29.01.2020 | permalink
Sattelschwein und Skudde: Schutz für einheimische Nutztierrassen nötig

Ob Deutsches Shorthorn, Schwarzes Bergschaf oder Sattelschwein – sie alle gehören zu den gefährdeten Nutztierrassen in Deutschland. Von den insgesamt 77 einheimischen Nutztierrassen der Großtierarten Pferd, Rind, Schwein, Schaf und Ziege gelten momentan immer noch 54 Rassen als gefährdet. Das geht aus der Roten Liste gefährdeter Nutztierrassen 2019 hervor, die von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Anfang Januar veröffentlicht wurde. Die Liste hält aber auch positive Neuigkeiten bereit: Die Bestandszahlen einiger Nutztierrassen haben sich auch aufgrund von Haltungsprämien positiv entwickelt. Dem Rhönschaf gelang dank staatlicher Förderprämien, erfolgreicher Erhaltungszuchtarbeit, der Zusammenarbeit mit dem Naturschutz und einem umfangreichen Regionalmarketing der Absprung von der Liste – es gilt nun nicht mehr als gefährdet. Auch das Brillenschaf, das vor allem in Süddeutschland verbreitet ist, konnte von der vormals höheren Kategorie „Erhaltungspopulation“ in die geringere Gefährdungsstufe „Beobachtungspopulation“ eingeordnet werden. Es gibt nun wieder 58 Böcke und 867 Mutterschafe.
Großer Handlungsbedarf bestehe hingegen bei den Rinderrassen: 15 der 21 einheimischen Rassen sind weiterhin gefährdet. Zur Erhaltungspopulation zählen etwa das Gelbvieh, das Limpurger oder Murnau-Werdenfelser, während Angler, Glanrind und Hinterwälder zur als etwas weniger gefährdert eingestuften Beobachtungspopulation gehören. Die Autoren berichten, dass es 1930 noch rund 400.000 Glan-Donnersberger Rinder gab. „Sie galten als anspruchslose, futterdankbare und gesunde Wirtschaftsrinder und wurden als Dreinutzungsrind Milch, Fleisch und Arbeit eingesetzt. Wie bei vielen anderen Rassen auch, führte das Streben nach höherer Milchleistung in den 1950er Jahren zu einer intensiven Verdrängungskreuzung, wodurch die Zucht des Glanrindes zum Erliegen kam“, schildern sie den Ursachen für den Populationsrückgang. Heute werden noch 82 Bullen und 953 Kühe auf der Liste geführt. „Das Glanrind wird heute gerne in der Landschaftspflege eingesetzt, da die Tiere auch Hänge und Steillagen abweiden und durch den Verbiss von Dornen und Sträuchern einer Verbuschung der Kulturlandschaft entgegenwirken“, schreiben die Autoren. Das BLE empfiehlt, die bislang erfolgreichen Instrumente, wie Haltungsprämien und Projektförderung von Bund und Ländern, beizubehalten, um die heimischen Rinderrassen wieder zu stärken.
„Die Begriffe Biologische Vielfalt oder Biodiversität sind derzeit in aller Munde. Die meisten Menschen denken dabei zuerst an die Vielfalt in der Insekten- Vogel- oder Pflanzenwelt“, betont Dr. Stefan Schröder, Leiter des Informations- und Koordinationszentrum für Biologische Vielfalt (IBV) der BLE im Vorwort des Berichts. „Die biologische Vielfalt in der landwirtschaftlichen Produktion und in der Ernährung gehört aber auch dazu. Es ist die Vielfalt der verschiedenen Nutzpflanzensorten und Nutztierrassen, die unsere zukünftige Ernährung sichert“, schreibt er. „Wir haben in Deutschland eine große Vielfalt an einheimischen Nutztierrassen, die an die besonderen Gegebenheiten ihres Ursprungsgebietes bestens angepasst sind. Viele dieser Rassen sind heute leider vom Aussterben bedroht.“ Als Ursachen nennt das BLE „die weltweiten und sich beschleunigenden Konzentrationsprozesse in der Land- und Ernährungswirtschaft“. Einer offensichtlichen Produktvielfalt im Lebensmitteleinzelhandel stehe in den vorgelagerten Produktionsstufen eine immer stärkere Vereinheitlichung gegenüber. „Der Marktdruck zur kontinuierlichen Produktion großer Mengen uniformer agrarischer Rohstoffe (wie z. B. Milch oder Fleisch) führt häufig zum Verschwinden vielfältig strukturierter Landwirtschaftsbetriebe.“ Viele Nutztierrassen würden daher unwirtschaftlich.
Nicht nur in Deutschland schwindet die Vielfalt der Nutztierrassen. Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO werden weltweit 38 Tierarten und 8.774 Rassen in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion genutzt. Davon sind 1.458 Tierrassen oder 17% vom Aussterben bedroht. Aufgrund der schlechten Datenlage sei zudem bei fast 60% der Nutztierrassen unklar, wie es um ihren Erhaltungszustand bestellt ist. In Europa ist bereits etwa die Hälfte aller zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch verbreiteten Tierrassen ausgestorben. Ein Drittel der bestehenden Rassen gilt als stark bestandsgefährdet. Um den Genpool zu bewahren und sicherzustellen, dass die Vielfalt seltener Nutztierrassen künftigen Generationen erhalten bleibe, seien also verstärkte Anstrengungen notwendig. Die FAO betont, dass die Erhaltung der Nutztierrassenvielfalt gerade in Zeiten des Klimawandels für die Welternährung enorm an Bedeutung gewinnen wird. (ab)
20.01.2020 | permalink
27.000 Menschen demonstrieren für eine Agrar- und Ernährungswende

Tausende Menschen haben am Samstag in Berlin für eine Agrar- und Ernährungswende demonstriert. Angeführt von 170 Traktoren zogen rund 27.000 Menschen unter dem Motto „Agrarwende anpacken, Klima schützen!“ vom Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel. Die „Wir haben es satt!“-Großdemonstration findet bereits zum 10. Mal am Rande der Grünen Woche und der Agrarminister-Konferenz in Berlin statt. Bei schönem Winterwetter ging eine bunte Menschenmenge aus Natur-, Klima- und Tierschützern, Bäuerinnen und Bauern, Jung und Alt auf die Straße und forderte unter anderem einen konsequenten Klimaschutz, mehr Unterstützung für Bauernhöfe und effektive Maßnahmen gegen das Insektensterben. Die teils aus ganz Deutschland angereisten Demonstranten trugen selbstgebastelte Plakate, waren als Schweine, Hühner oder Bienen verkleidet oder verliehen mit Kochtöpfen und Trommeln ihrem Ärger über die Agrarpolitik der Bundesregierung lautstark Ausdruck. „Wir haben die Alibi-Politik des Agrarministeriums gehörig satt!“, äußert die Sprecherin des „Wir haben es satt!“-Bündnisses, Saskia Richartz. „Die Bundesregierung trägt die Verantwortung für das Höfesterben und den Frust auf dem Land. Seit 2005, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, mussten 130.000 Höfe schließen – im Schnitt gab ein Familienbetrieb pro Stunde auf.“
Schon am Vormittag überreichten die Bäuerinnen und Bauern, die auf ihren Treckern aus dem ganzen Bundesgebiet angereist waren, eine Protestnote, die sich an die bei der Internationalen Agrarministerkonferenz vertretenen Ministerinnen und Minister aus aller Welt richtet. Ihre Botschaft lautet: Statt mit unfairen Freihandelsabkommen neue Märkte für Auto- und Chemie-Konzerne zu erschließen, braucht es gerechten Handel, die Durchsetzung von Bauernrechten und Schutz von bäuerlichen Betrieben auf der ganzen Welt. Das Demobündnis forderte ein Veto Deutschlands gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. „Kein Mercosur! Für Vielfalt in Feld und Flur“ war auf einem der Trecker auf der Demo zu lesen. Der brasilianische Uniprofessor und Agrarexperte Antonio Andrioli erläutert: „Das geplante Freihandelsabkommen (…) wäre fatal für die bäuerliche Landwirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks. Damit würde sich das agrarindustrielle Modell mit Gentechnik, Pestiziden und Tierfabriken noch mehr verfestigen. Wir freuen uns, dass auch in Deutschland der Protest gegen das Abkommen wächst.“ Deutschland müsse ein Veto einlegen, auch damit die Brandrodungen im Amazonas eingedämmt werden. Bundesagrarministerin Julia Klöckner nahm die Protestnote persönlich entgegen und wandte sich, balancierend auf einer Milchkanne, mit einer kurzen Rede an die Demonstranten.
Das Bündnis fordert von der Bundesregierung ein Umsteuern bei der EU-Agrarreform. Deutschland komme bei der EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) zu. Das Bündnis fordert, die rund 60 Milliarden an Fördergeldern pro Jahr für eine sozial-gerechte und ökologische Agrarreform einzusetzen und mit gezielten Subventionen für artgerechte Tierhaltung und mehr Klima- und Umweltschutz zu sorgen. „EU-Geld nützt, wenn‘s die Umwelt schützt“ oder „Agrarwende jetzt: Gerechte Preise und eine bäuerlich ökologische Agrarförderung“ war auch auf den Schildern der Demonstranten zu lesen. „Ja, wir werden eine andere europäische Agrarpolitik bekommen, denn die Bürger, der Steuerzahler wird nicht mehr bereit sein, mehr Geld in die Hand zu nehmen für eine Politik, die in der Vergangenheit finanziert worden ist“, sagte Klöckner. „Wenn es mehr Geld geben sollte, dann nur für eine Politik mit neuen Ansätzen und die bedeuten Ecoschemes, Umweltleistungen, die Abgeltung der Mehrleistung im Sinne des Allgemeinwohls.“ Doch den Demonstranten ging es nicht um mehr Geld, sondern darum, dass die bisherigen Agrarmilliarden für mehr Klima- und Umweltschutz eingesetzt wird. „Reden reicht nicht, die Zeit der Ankündigungen ist vorbei“, betonte Richartz. „Wir messen Agrarministerin Klöckner daran, was bei ihrer Politik unter dem Strich für Bauernhöfe, Tiere und das Klima herauskommt. Bislang ist diese Ministerin in dieser Hinsicht eine Nullnummer!“ (ab)
17.01.2020 | permalink
Deutsche Agrarkonzerne: Mangelnder Menschenrechtsschutz in Lieferketten

Die größten deutschen Agrarkonzerne ergreifen keine ausreichenden Maßnahmen gegen die Verletzung von Menschenrechten in ihren Lieferketten. Das zeigt eine Studie der Organisationen Germanwatch und Misereor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Darin wurden die größten Unternehmen aus der Geflügelfleisch-, Milch-, Futtermittel- und Agrarchemiebranche in Deutschland unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist ernüchternd: „Kein einziges der insgesamt 15 Unternehmen erfüllt ausreichend die Anforderungen der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“, sagt Cornelia Heydenreich von Germanwatch, Autorin der Studie. „Die Achtung der Menschenrechte ist bei den Geschäften dieser Unternehmen oft nicht sichergestellt.“ Dabei kommt es gerade in der Ernährungsindustrie und Landwirtschaft rund um den Globus häufig zu Menschenrechtsverletzungen, von denen Produzenten, Konsumenten oder Menschen vor Ort entlang der Wertschöpfungskette betroffen sein können. Dazu gehören die Verwehrung des Zugangs zu Land und Wasser, Gesundheitsschäden durch den Einsatz von Pestiziden, ausbeuterische Arbeitsbedingungen auf Plantagen oder die Marktverdrängung von Kleinbetrieben durch Dumpingexporte. Obwohl es viele Belege für Menschenrechtsverletzungen unter Beteiligung deutscher Unternehmen im Ausland gibt, konnten Betroffene bisher noch nie eine Entschädigungsklage vor deutschen Gerichten einreichen, kritisiert die Studie.
Für die Erhebung versandten die Organisationen Fragebögen an die größten in Deutschland operierenden Geflügelproduzenten (PHW-Gruppe, Rothkötter, Sprehe Gruppe, Heidemark und Plukon) und Molkereien (Müller-Milch, Deutsches Milchkontor, Arla Foods, Friesland Campina und Hochwald), die Futtermittelunternehmen Agrarvis Raiffeisen, BayWa und Cargill sowie die Chemiekonzerne BASF und Bayer. Zudem wurden menschenrechtliche Grundsatzerklärungen, unternehmensinterne Verhaltenskodizes, Kodizes für Lieferanten, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte und die Unternehmenswebseiten ausgewertet. Acht der befragten Unternehmen antworteten. Die Studie gelangt zu dem Fazit, dass die Agrarkonzerne ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten bisher nur ungenügend umsetzen. Nur sieben Unternehmen verfügen über eine Grundsatzerklärung zu Menschenrechten, die den Mindestanforderungen der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte entspricht. Arla habe als einziges Unternehmen bislang eine systematische menschenrechtliche Folgenabschätzunge durchgeführt. Gegenmaßnahmen zur Vermeidung oder Beendigung von Menschenrechtsverletzungen oder Reaktionen gab es meist nur, wenn bereits öffentlich über Missstände berichtet wurde. „Die Studie zeigt, wie wichtig ein Lieferkettengesetz ist, das deutsche Unternehmen verbindlich zur menschenrechtlichen Sorgfalt verpflichtet“, betont Mitautor Armin Paasch von MISEREOR.
Der Studie zufolge gibt es vor allem im Geflügelfleischsektor hohe menschenrechtliche Risiken. Der Sojaanbau für Futtermittel führe vielfach zu Landvertreibungen und zum Einsatz giftiger Pestizide in Südamerika. Auch die Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachtbetrieben seien zum Teil menschenverachtend. Exporte von Geflügelteilen aus der EU bedrohten in Westafrika das wirtschaftliche Überleben einheimischer Produzenten und gefährdeten ihre Lebensgrundlage. „Angesichts der bisher beobachteten Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Geflügelfleisch ist es erschreckend, dass sich diese Branche laut unserer Untersuchung am wenigsten mit den menschenrechtlichen Risiken beschäftigt“, moniert Heydenreich. Rothkötter, Sprehe und Heidemark hätten sich noch gar nicht öffentlich verpflichtet, die Menschenrechte zu achten. Auch die beiden anderen Geflügelunternehmen sehen allenfalls bedingt ihre Lieferanten in der Pflicht. Doch auch bei den anderen Branchen sehen die Organisationen große Defizite.
Der Bundesregierung stellt die Studie kein besseres Zeugnis aus, sondern wirft ihr vor, es versäumt zu haben, in der Handelspolitik Menschenrechtsstandards wirkungsvoll zu verankern. Paasch verweist darauf, dass Handelsabkommen der EU in Ländern des globalen Südens mitunter den Zugang von Kleinproduzenten zu Märkten, Saatgut und Land gefährden. „Die Bundesregierung hatte zugesagt, sich in der EU für wirkungsvollere Nachhaltigkeitsfolgenabschätzungen und verbindliche Menschenrechtsstandards in Handelsabkommen einzusetzen, ist bislang aber untätig geblieben.“ Die Organisationen warnen insbesondere aufgrund der massiven Menschenrechtsverletzungen und Regenwaldabholzung in Brasilien vor der Ratifizierung des EU-Handelsabkommens mit den Mercosur-Staaten. Zudem fordern sie die Bundesregierung auf, zügig ein Lieferkettengesetz auszuarbeiten und zu beschließen, wie es Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller angekündigt hatten, nachdem ein Monitoring im Auftrag der Bundesregierung ergeben hatte, dass nur ein Fünftel der deutschen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommen. Auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, sieht Handlungsbedarf. „Wir haben den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, sich selbst auf die Einhaltung von Standards in ihren Lieferketten zu verpflichten, doch die Evaluierung hat gezeigt, dass da zu wenig passiert ist“, sagte er dem Handelsblatt. „Deshalb brauchen wir auch hier verbindliche Spielregeln.“ (ab)
16.01.2020 | permalink
EU-Mercosur: Mieser Deal für Klimaschutz und kleine Produzenten
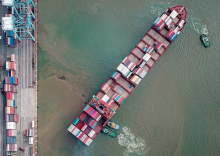
Das Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten läuft dem Klimaschutz zuwider. Dies ist das Fazit einer Studie, die von Wissenschaftlern des argentinischen Forschungsrats CONICET erstellt wurde. Das Abkommen wird nicht nur zu höheren Treibhausgasemissionen aufgrund von Entwaldung beitragen, sondern durch geringere oder entfallende Zölle auch die Handelsströme und so den Ausstoß von CO2 erhöhen. Im Juni 2019 hatten sich die EU und die Mercosur-Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay nach 20 Jahren zäher Verhandlungen auf ein Handels- und Assoziierungsabkommen geeinigt. Die Studie, die von den europäischen Grünen/EFA in Auftrag gegeben wurde, analysiert die Vereinbarungen und Mechanismen, die das mehrere hundert Seiten starke Abkommen enthält und befasst sich mit möglichen Folgen, wenn es in Kraft treten sollte. Dr. Luciana Ghiotto und Dr. Javier Echaide werteten zudem Literatur, Folgenabschätzungen und Analysen verschiedener Interessenvertreter zum Vertragswerk aus. Ihr Ergebnis: In der aktuellen Form untergräbt das Abkommen die Bemühungen um eine Eindämmung des Klimawandels.
„Die EU wird mehr Fleisch und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse importieren. Mit ihnen werden wir Emissionen, Entwaldung, Bodenverunreinigung und Menschenrechtsverletzungen importieren – und gleichzeitig die Lebensgrundlagen der hiesigen Landwirte gefährden“, schreibt die Herausgeberin und Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini im Vorwort. „Im Gegenzug werden die Mercosur-Staaten mehr Autos, Chemikalien und Maschinen importieren und somit die Verlagerung der regionalen Wertschöpfungsketten riskieren.“ Ein Kapitel der Studie widmet sich dem Handel mit Agrargütern: „Was den Marktzugang für landwirtschaftliche Erzeugnisse angeht, so wird das Abkommen in beiden Blöcken Gewinner und Verlierer hervorbringen“, schreiben die Autoren. Der Mercosur stimmte der Liberalisierung von 93% seiner Zolllinien für Agrar- und Lebensmittelimporte aus der EU zu. Die EU wird im Gegenzug 82% der Agrarimporte liberalisieren. Bei den übrigen Importen gibt es Verpflichtungen zu Teilliberalisierungen, einschließlich Zollkontingente für sensible Produkte wie Rindfleisch, Geflügel, Schweinefleisch, Zucker, Ethanol und Reis.
Auf die vier Mercosur-Länder entfallen schon heute fast 80% aller Rindfleischimporte der EU, rund 270.000 Tonnen waren es im Jahr 2018. Für Geflügel hat die EU den Mercosur-Staaten, vor allem Brasilien, im Abkommen eine Quote von 180.000 Tonnen zusätzliches Geflügelfleisch gewährt. Die CO2-Emissionen im Zusammenhang mit dem Anstieg der Geflügelimporte in die EU würden dadurch voraussichtlich um 6% steigen. Beim Schweinefleisch hat die EU einen niedrigeren Zollsatz von 83 Euro je Tonne für 25.000 Tonnen zugesagt, wodurch sich die Importe aus dem Mercosur fast verdoppeln könnten. Die Menge ist zwar gering im Vergleich zur Schweinfleischproduktion der EU selbst, die jährlich mehr als 3,3 Millionen Tonnen exportiert. Doch Cavazzini kritisiert die „Unlogik des Imports von Lebensmitteln, die bereits in der EU produziert und aufgrund von Überproduktion sogar“ exportiert werden. „Das Abkommen setzt zudem die Landwirtschaft in der EU durch billige Fleischimporte weiter unter Druck. Die Qualität eben dieser Importe ist außerdem nicht gewährleistet: Denn trotz größerer Menge Importe vereinfacht der Deal Zollkontrollen“, so Cavazzini. Dass es derzeit bereits Probleme bei der Einhaltung von Standards gebe, zeigten die jüngsten Gammelfleisch-Skandale in Brasilien und der hohe Einsatz von Pestiziden und Gentechnik in der Landwirtschaft dort.
Für Ethanolimporte in die EU sieht das Abkommen eine Quote von 650.000 Tonnen pro Jahr vor, wovon 450.000 Tonnen für chemische Zwecke zollfrei und der Rest zu einem ermäßigten Satz eingeführt werden dürfen. Diese Quoten sind im Vergleich zum derzeitigen Handel sehr hoch. In Brasilien ist daher mit einem weiteren Anstieg der Produktion von Zuckerrohr und Mais für die Ethanolproduktion zu rechnen – und damit auch mit verstärkter Abholzung. Durch die Zuwächse beim Handel mit Ethanol könnte so ein Emissionsplus von 4% entstehen, schätzen die Autoren. Da das Abkommen gerade den Handel mit Agrarerzeugnissen fördert, die mit Entwaldung einhergehen, etwa für die Gewinnung von Weideflächen für Rinder, oder die größtenteils in Monokulturen mit hohem Pestizideinsatz angebaut werden, wie Gentechnik-Soja, werden Klima und Umwelt leiden. Aber die Emissionen steigen nicht nur durch Entwaldung und Landnutzungsänderungen in den Mercosur-Staaten, sondern auch durch die Handelszuwächse. „Bestimmte Produkte werden international gehandelt, obwohl sie ein paar Kilometer von den Verbrauchern entfernt im Mercosur oder in den EU-Ländern produziert werden, wie Tomaten, Kartoffeln und frische Früchte, doch nun werden sie 10.000 Kilometer in Schiffen von zum Beispiel Rom nach Montevideo zurücklegen“, so die Verfasser.
Auch entwicklungspolitisch ist das Abkommen zu hinterfragen, betont Cavazzini. Denn eine Folge des Mercosur-Deals sei eine noch weiter vertiefte wirtschaftliche Ausrichtung der Mercosur-Länder auf die Produktion und Förderung von Primärrohstoffen. „Statt die Wirtschaft zu diversifizieren und nachhaltig aufzustellen, zementiert der Deal die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Export von Agrargütern noch weiter.“ Das stehe einer souveränen wirtschaftlichen Entwicklung der Mercosur-Länder entgegen. „Das Abkommen wird die bestehenden wirtschaftlichen Asymmetrien aufrechterhalten und vertiefen. Die Sektoren, die in beiden Blöcken profitieren werden, sind jene, die bereits global wettbewerbsfähig sind – in der EU der Industriesektor und im Mercosur die Agrarindustrie“, warnen die Autoren. „Das Abkommen wird zudem erhebliche Auswirkungen auf landwirtschaftliche Kleinerzeuger auf beiden Seiten des Atlantiks haben. Während die wirtschaftliche Macht in den Händen einiger weniger großer Exporteure von Agrarprodukten konzentriert wird, werden die kleinen Betriebe die nachteiligen Folgen einer weiteren Liberalisierung der Landwirtschaft zu spüren bekommen.“ (ab)
13.01.2020 | permalink
Atlas: Insektenbestände befinden sich im Abwärtstrend

Insekten bestäuben drei Viertel der wichtigsten Kulturpflanzen und steigern ihren Ertrag, doch ihre Bestände gehen dramatisch zurück – weltweit und auch in Deutschland. Das zeigt der Insektenatlas 2020 auf, der am 8. Januar von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland veröffentlicht wurde. Darin wurden zahlreiche Daten und Fakten über Nütz- und Schädlinge in der Landwirtschaft zusammengetragen und Studienergebnisse aufbereitet. Egal ob Langzeituntersuchungen, einzelne Studien oder Rote Listen – das Ergebnis ist immer das gleiche: Alle Datenreihen belegen einen Rückgang der Artenvielfalt und bestätigen eine teilweise dramatische Abnahme der Populationsdichte. So sind hierzulande bei etwa der Hälfte der 561 Wildbienenarten die Bestände rückläufig. Über einen Zeitraum von 46 Jahren ging auf der Schwäbischen Alb die Anzahl der Nester einer Schmalbienenart um 95% zurück. In den Isarauen im bayerischen Dingolfing sind drei Viertel der Wildbienenarten innerhalb nur eines Jahrzehnts verschwunden. Doch auch andere Insektengruppen sind dem Atlas zufolge in Gefahr: Zikadenpopulationen auf Trockenrasen in Ostdeutschland nahmen über 40 bis 60 Jahre um 54% ab und im Feuchtgrünland in Niedersachsen betrugen die Verluste sogar 78%.
Als eine der Hauptursachen für den globalen Insektensschwund machen die Autoren die intensive Landwirtschaft mit ihren Folgen für die Lebensgrundlage von Insekten aus. „Weltweit treiben Monokulturen mit Energie- oder Futterpflanzen für unsere Massentierhaltung in Ländern wie Brasilien oder Indonesien die Entwaldung, monotone Agrarwüsten und den Pestizideinsatz massiv voran. So hat sich alleine in Argentinien der Pestizideinsatz seit den 1990er Jahren verzehnfacht“, sagt Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie kritisiert, dass Pestizide von Chemieriesen wie Bayer und BASF, die in der EU längst verboten oder nicht mehr lizensiert sind, weltweit weiterhin fast unbeschränkt gehandelt werden. So sei etwa in Kenia fast die Hälfte der Pestizide hochtoxisch für Bienen und in Brasilien seien es über 30%. Hier drohe eine Verschärfung der Lage durch das Mercosur-Abkommen, das eine Zollreduktion für Chemieprodukte vorsehe, unter die auch Pestizide fallen. „Das Ziel noch mehr Pestizide in die artenreichsten Regionen der Welt zu exportieren verhöhnt alle nationalen Nachhaltigkeitsbemühungen. Pestizide, die in Europa aufgrund ihrer gesundheitsschädlichen oder gravierenden ökologischen Wirkung nicht mehr zugelassen sind, dürfen von deutschen Konzernen auch nicht länger in anderen Ländern vertrieben werden“, fordert der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt.
Der Insektenatlas betont zudem, dass eine Reduzierung des Fleischkonsums einen Beitrag zum Insektenschutz leisten kann: „Ein Blick auf die Felder vor unserer Haustür reicht dabei nicht. Die importierten Futtermittel für die vielen Millionen Nutztiere, die den weltweiten Hunger auf billiges Fleisch befriedigen, wachsen vor allem in Südamerika. Dort, in den artenreichsten Regionen der Welt, werden Millionen Hektar Wald gerodet gerodet und für die Soja- und Fleischproduktion nutzbar gemacht“, schreiben die Herausgeber im Vorwort. „Wir müssen beim Insektenschutz auch unseren Lebensstil hinterfragen: Weniger Fleisch und Milch, dafür artgerecht gehalten und mit fairen Preisen für die Bauernhöfe, das wäre wichtig. Die im Einklang mit der Natur wirtschaftenden Landwirtinnen und Landwirte brauchen ein einträgliches Auskommen. Doch Insektenschutz wird bislang nicht an der Ladenkasse bezahlt, Bäuerinnen und Bauern bekommen ihn nicht entlohnt“, erläutert Bandt. Hier sehen die Herausgeber auch den Handel in der Pflicht, für faire Erzeugerpreise zu sorgen.
Die von der Politik bisher ergriffenen Maßnahmen seien nicht ausreichend, um das Insektensterben zu beenden. „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig, wie gravierend das fortschreitende Insektensterben ist. Doch politisch gehandelt wurde bisher kaum“, sagt Bandt. „Die Vorschläge der Bundesregierung im Insekten-Aktionsprogramm reichen nicht aus. Ohne einen Umbau der Landwirtschaft ist das Sterben von Schmetterlingen, Hummeln und Käfern nicht zu stoppen.“ Um diese Agrarwende voranzubringen, müsse die Agrarpolitik Betriebe dabei unterstützen, weniger Pestizide einzusetzen, weniger Dünger auszubringen und mehr Lebensräume für Insekten zu schaffen. „Die Landwirtschaft muss beim Schutz der Insekten Teil der Lösung werden. Es braucht deshalb für Bäuerinnen und Bauern mehr Beratung und andere Fördermittel, aber es braucht auch klare gesetzliche Vorgaben, beispielsweise in Schutzgebieten“, fordert Bandt. „Öffentliches Geld muss zum Schutz der Insekten eingesetzt werden.“ (ab)
06.01.2020 | permalink
Planetare Grenzen: Wechselwirkungen verstärken Druck auf das System Erde

Ein Team von Wissenschaftlern präsentierte 2009 das Konzept der planetaren Grenzen und machte neun Prozesse und Systeme aus, die für die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Erde entscheidend sind. Wird in diesen Bereichen die Belastungsgrenze des Erdsystems überschritten, drohen abrupte und unumkehrbare Umweltveränderungen im großen Stil. In einem Update des Konzepts konstatierten die Wissenschaftler 2015, dass die Menschheit bereits in vier Bereichen den sicheren Betriebsbereich verlassen hat: bei Klimawandel, Landnutzungsänderungen, dem menschlichen Eingriff in biogeochemische Kreisläufe (Stickstoff und Phosphor) sowie bei der Integrität der Biosphäre (Verlust der biologischen Vielfalt und Artensterben). Nun zeigt eine Mitte Dezember in der Zeitschrift „Nature Sustainability“ erschienene Studie, dass das Überschreiten der Belastungsgrenze in einem Bereich auch den Druck auf andere verstärken kann. „Wir haben festgestellt, dass ein dichtes Netzwerk von Wechselwirkungen zwischen den planetaren Grenzen besteht“, sagt Johan Rockström, Mitautor der Studie. Der Klimawandel und die Intaktheit der Biosphäre sind zwei Schüsselgrenzen – mehr als die Hälfte der Gesamtkraft aller Wechselwirkungen entfällt auf diese Bereiche. „Dies zeigt, dass wir uns davor hüten sollten, diese beiden Bereiche zu destabilisieren“, fügte Rockström hinzu.
Die Wissenschaftler quantifizierten die Wechselwirkungen zwischen den neuen Prozessen im Erdsystem. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass die biophysikalischen Interaktionen die direkten menschlichen Auswirkungen auf die neun planetaren Grenzen fast verdoppelt haben. Ein Beispiel dafür, wie sich der Einfluss des Menschen auf das Erdsystem wechselseitig verstärkt, ist der Zusammenhang zwischen Entwaldung und Klimawandel. Das Abbrennen tropischer Regenwälder, um landwirtschaftliche Nutzflächen auszuweiten, erhöht den CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Die zusätzlichen Treibhausgase tragen dann zur globalen Erwärmung bei – der Schaden an den Wäldern beeinträchtigt somit auch die Klimastabilität. Der Temperaturanstieg kann wiederum Druck auf die Regenwälder ausüben, was auch mit negativen Folgen für die Landwirtschaft einhergeht. Die daraus resultierende Verstärkung der Auswirkungen ist erheblich. Es könnte aber noch schlimmer kommen, denn die Studie berücksichtigt noch keine Kipp-Punkte. So könnte sich etwa der Amazonas-Regenwald jenseits einer bestimmten Grenze schnell und nichtlinear verändern. Ein solches Kippverhalten würde die in der Studie untersuchte Wirkungsverstärkung noch mehr antreiben.
Ein weiteres beunruhigendes Beispiel für Verbindungen zwischen globalen Umweltproblemen, die den Einfluss des Menschen auf das Erdsystem verstärken, sind die katastrophalen Buschbrände, die derzeit an der australischen Südostküste wüten. „Der Klimawandel hat durch steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster eine bedeutende Rolle bei der Schaffung der Bedingungen gespielt, die solche massiven und ausgedehnten Brände begünstigen“, sagte der Hauptautor der Studie, Dr. Steven Lade von der Australian National University. „Die Buschfeuer wiederum wirken sich auf das Klima aus, indem sie große Mengen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre freisetzen und so durch eine sogenannte ‚Rückkopplungsschleife‘ den Klimawandel weiter anheizen.“ Dr. Lade betont zudem, dass Rauch im Gegensatz zu anderen Aerosolen auch Sonnenstrahlung absorbiert, was den Klimawandel weiter beschleunigt. „Die Schwere der Brände in Verbindung mit dem fortschreitenden Klimawandel könnte zu einer Verschiebung im Ökosystem führen, wenn sich die Landschaft dann erholt“, warnt er. „Wenn neue Ökosysteme weniger Kohlenstoff speichern als die abgebrannten Wälder, kommt es langfristig zu einem Nettoanstieg des Kohlenstoffdioxids in der Atmosphäre.“
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass ein umfassendes Verständnis der Dynamik des Erdsystems wichtig ist, damit wir auf eine nachhaltige Zukunft zusteuern können“, schreiben die Autoren. Sie verleihen der Hoffnung Ausdruck, dass ihre Erkenntnisse nun für die Entwicklung von politischen Maßnahmen zur Sicherung der Lebensgrundlagen künftiger Generationen genutzt werden. „Wir bieten unsere Untersuchung zu den Wechselwirkungen zwischen den planetaren Grenzen der Politik und der wissenschaftliche Gemeinschaft an“, schreiben sie – „als eine Zusammenfassung des aktuellen Wissensstandes, als ein Aufruf an die künftige Forschung, die Wechselwirkungen besser zu charakterisieren und als einen Rahmen, um politische Diskussionen und Pläne für eine nachhaltige Zukunft anzuregen.“ Rockström betont, dass die Ergebnisse der Studie gute Nachrichten für politische Entscheidungsträger enthalten: „Wenn wir unseren Druck auf eine planetare Grenze reduzieren, wird dies in vielen Fällen auch den Druck auf andere planetare Grenzen verringern. Nachhaltige Lösungen verstärken ihre Wirkung – das kann eine echte Win-Win-Situation sein.“ (ab)
- PIK Research Portal: Planetare Grenzen: Wechselwirkungen im Erdsystem verstärken menschgemachte Veränderungen
- Nature Sustainability: Human impacts on planetary boundaries amplified by Earth system interactions
- Australian National University: Environmental problems amplify human impact on Earth System
- Link to the study

