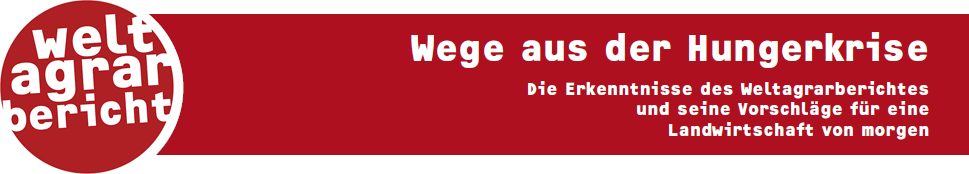Nachrichten
29.09.2016
Landraub: Oxfam warnt vor zunehmenden Konflikten und Vertreibungen

Allein in den letzten vier Jahren haben Regierungen und Investoren weltweit Verträge über Landdeals abgeschlossen, die eine Fläche so groß wie Deutschland umfassen. Dies birgt die Gefahr, dass Millionen Menschen von ihren Flächen vertrieben werden und Landkonflikte eskalieren, warnt die Entwicklungsorganisation Oxfam. In einem neuen Bericht belegt Oxfam anhand von sechs Fallbeispielen, dass die weltweiten Landnahmen durch Regierungen und Konzerne Methode haben. „Wir treten in eine neue und noch gefährlichere Phase des globalen Runs auf Ackerland ein“, sagt Winnie Byanyima, Geschäftsführerin von Oxfam International. „Der fieberhafte Handel mit Millionen Hektar Wald, Küstengebieten und Ackerland hat zu Mord, Vertreibung und Ethnozid geführt. Landverträge werden unterzeichnet und Projekte begonnen ohne die Zustimmung der dort lebenden Gemeinden. Dies schafft den Nährboden für wachsende Konflikte in den kommenden Jahren, wenn Landrechte jetzt nicht besser geschützt werden“, warnt sie. Das von Oxfam kritisierte Ausmaß der Landverkäufe wird eindrücklich belegt durch Zahlen aus einem noch unveröffentlichten Bericht der Land Matrix, einem Zusammenschluss internationaler Nichtregierungsorganisationen. Demnach wurden 75% der in den letzten 16 Jahren vereinbarten 1500 Landgeschäfte in Vertragsform gegossen und die geplanten Projekte nehmen Gestalt an – das sind drei Mal so viele vertraglich abgesicherte Geschäfte im Vergleich zur letzten Bestandsaufnahme vor vier Jahren. Bis zu 59% der Deals betreffen Gemeindeland, das von indigenen Völkern und kleineren Gemeinschaften beansprucht wird, deren traditionelle Besitzrechte selten von Regierungen anerkannt werden. Ein Dialog mit den Gemeinden findet in der Regel nicht statt, Morde sowie Vertreibungen ganzer Dörfer nehmen zu. „Millionen Menschen ihr Land wegzunehmen, ist der weltweit größte Angriff auf die Identität, die Würde, die Sicherheit der Menschen und schadet auch der Umwelt“, erklärt Marita Wiggerthale von Oxfam Deutschland. „Sichere Landrechte sind zentral, um Hunger und soziale Ungleichheit zu mindern sowie den Klimawandel zu bekämpfen.“ Doch gerade daran mangelt es in vielen Weltregionen, wie der Oxfam-Bericht anhand von Beispielen aufzeigt. So kämpfen die Quechua, eines der 55 indigenen Völker in Peru, seit Jahren um Landtitel, während die Regierung lieber Lizenzen zur Ölbohrungen an Konzerne vergibt. Auch die Aborigines in Australien haben einen schweren Stand. In Sri Lanka vertrieb das Militär im Jahr 2010 in der Region Paanama insgesamt 350 Familien gewaltsam aus ihren Dörfern, um das Land für Militärcamps und Hotels zu nutzen. „Sie kamen nachts. Maskierte und bewaffnete Männer setzten Häuser und Felder in den Küstendörfern Shasthrawela und Ragamwela in Brand“, zitiert der Oxfam-Bericht einen Dorfbewohner. Die Menschen können keine Lebensmittel mehr anbauen und müssen Geld für Essen ausgeben, das an anderer Stelle fehlt. Das Land befand sich seit Generationen im Besitz der Dorfgemeinschaft, doch offiziell kann in Sri Lanka eine Gemeinde keinen gemeinsamen Landtitel erwerben, da dies nur Einzelpersonen oder Vereinen gestattet ist. Zwar beschloss die Regierung im Jahr 2015 die Rückgabe des Landes, doch getan hat sich seither nichts. Oxfam fordert daher die sofortige Rückgabe der 137 Hektar Land an die betroffenen Familien, um so ein klares Zeichen gegen Landraub und für den Schutz von Landrechten setzen. (ab)
27.09.2016
Bericht fordert mehr Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung

Regierungen und Unternehmen weltweit müssen den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung verstärken, um das Nachhaltigkeitsziel 12.3 zu erreichen. So lautet die Botschaft eines am 22. September erschienenen Berichts von Champions 12.3, einem Bündnis aus Regierungs- und Unternehmensvertretern und der Zivilgesellschaft. Der Bericht zieht Bilanz zu den Fortschritten bei Unterziel 12.3 der im Herbst 2015 von der internationalen Gemeinschaft verabschiedeten Sustainable Development Goals (SDGs). Target 12.3 sieht vor, bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene zu halbieren und die in der Produktions- und Lieferkette entstehenden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten zu verringern. Dem Bericht zufolge haben Regierungen und Organisationen in Europa, Afrika und den USA im letzten Jahr schon eine Reihe beachtlicher Maßnahmen ergriffen, doch angesichts des Ausmaßes des Problems sind stärkere Anstrengungen vonnöten. Ein Drittel aller weltweit erzeugten Lebensmittel gelangt nie auf unsere Teller. Dies verursacht jährlich $940 Milliarden an wirtschaftlichen Einbußen und 8% aller Treibhausgasemissionen. „Die Verringerung von Lebensmittelverlusten und Verschwendung zahlt sich dreifach aus: Sie trägt dazu bei, mehr Menschen zu ernähren, spart Kosten für Bauern, Unternehmen und Haushalte und kann den Druck auf Klima, Wasser und Landressourcen vermindern“, betont der Bericht. Die Autoren empfehlen allen Beteiligten, zügig aktiv zu werden und erstens Ziele festzulegen, zweitens Fortschritte zu messen und drittens zu handeln. Jedes Land, jede Stadt und jedes Unternehmen in der Lebensmittelkette solle sich klare Zielvorgaben zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung im Einklang mit DSG-Target 12.3 setzen. Teilweise sei dies schon geschehen. So hätten die USA angekündigt, bis 2030 die Lebensmittelabfälle gegenüber 2010 halbieren zu wollen. Doch der Bericht warnt, dass sich nur einige Regionen und größere Konzerne Ziele gesetzt hätten, während viele Schwellenländer sowie Unternehmen in der Lebensmittelkette noch nichts unternommen hätten. Auch bei der Messung des Fortschritts sieht der Bericht trotz Erfolgen noch viel Luft nach oben und ruft Regierungen und Unternehmen auf, das Ausmaß des Problems zu quantifizieren. Da der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung auf nationaler und regionaler Ebene erfolge, seien auch Zahlen auf dieser Ebene notwendig. Großbritannien etwa verfüge dank umfassender Erhebungen, z.B. durch die NGO WRAP, über detaillierte Daten auf Landesebene. Auch die EU habe für ihre Mitgliedsstaaten Schätzungen veröffentlicht. Im Privatsektor sei die Supermarktkette Tesco federführend, die seit 2013 jährlich Bestandsaufnahmen veröffentlicht. „Das war ein entscheidender Schritt, der uns gezeigt hat, wo wir unsere Anstrengungen bündeln müssen. Sobald wir die Problembereich identifiziert hatten, wussten wir, wo Handlungsbedarf bestand“, erklärt Tesco-Chef Dave Lewis. Doch letztendlich kommt es auf aktives Handeln aller Staaten, Unternehmen, Landwirte und Bürger an. Seit Verabschiedung der SDGs sei schon viel passiert: Frankreich und Italien hätten 2016 Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung verabschiedet und so z.B. Anreize geschaffen, dass Supermärkte noch essbare Lebensmittel spenden statt entsorgen. Doch es ist noch viel zu tun, schlussfolgern die Autoren und fordern Regierungen und Unternehmen dazu auf, Politiken, Initiativen und Praktiken anzustoßen und zu fördern, die der ungeheuerlichen Verschwendung effektiv entgegenwirken. (ab)
21.09.2016
Billig hat seinen Preis: die externen Kosten der industriellen Landwirtschaft

Die industrielle Landwirtschaft hat ihren Preis: Würden die externen Kosten z.B. durch die Nitratbelastung des Trinkwassers aufgrund von Überdüngung oder den Antibiotikaeinsatz in der Intensivtierhaltung einkalkuliert, wäre der Preisunterschied zwischen ökologisch und konventionell produzierten Lebensmitteln deutlich geringer. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die Wissenschaftler der Universität Augsburg im Auftrag des Aktionsbündnisses „Artgerechtes München“ erstellt und am 15. September auf einer Pressekonferenz in München vorgestellt haben. „Die Preise, die Verbraucher für Lebensmittel bezahlen, spiegeln deren wahre Kosten häufig nur unzureichend wider. Denn viele, insbesondere soziale, gesundheitliche und ökologische (Folge-)Kosten der Nahrungsmittelproduktion sind in den aktuellen (Markt)Preisen nur unzureichend oder oftmals gar nicht enthalten“, fassen die Autoren der Arbeitsgruppe „Märkte für Menschen” zusammen. Diese versteckten Kosten betreffen zum Beispiel die Nitrat-/Stickstoffbelastung: Bei der Düngung landwirtschaftlich genutzter Böden entstehen häufig reaktive Stickstoffüberschüsse, die dem Ökosystem, dem Klima und der Gesundheit des Menschen schaden. Die Folgekosten fallen häufig erst zeitlich versetzt an, weshalb es schwierig ist, sie dem Verursacher des Stickstoffproblems zuzuordnen – daher zahlt die Allgemeinheit. Die Wissenschaftler haben eine Kosten-Nutzen-Rechnung von Stickstoff in der deutschen Landwirtschaft aufgestellt: Kosten von 20,24 Milliarden für die menschliche Gesundheit, das Ökosystem und das Klima, z.B. für die Reinigung des Trinkwassers oder Gesundheitskosten durch Folgeerkrankungen, steht ein Nutzen für die Landwirtschaft von 8,71 Milliarden gegenüber. Unterm Strich entstehen externe Folgekosten von 11,53 Milliarden Euro pro Jahr. „Wenn Sie sich die gesamte Bruttowertschöpfung der deutschen Landwirtschaft ansehen, dann sind wir da bei 17,4 Milliarden. Das muss man einmal in Vergleich setzen, das ist eine ganz erhebliche Marktverzerrung aus ökonomischer Sicht“, äußerte Stephanie Weigel, Sprecherin des Bündnisses „Artgerechtes München“ gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Der Löwenanteil der externen Kosten fällt bei konventionell produzierten tierischen Lebensmitteln an, für pflanzliche Bioprodukte berechnet die Studie den geringsten „Stickstoff-Schadensfaktor“. Würden die Kosten verursachergerecht auf die Lebensmittelpreise aufgeschlagen, wäre Fleisch aus Massentierhaltung 9,7% teurer als bisher. „Wenn die Folgekosten, insbesondere der konventionellen Nutztierhaltung, auch weiterhin unzureichend Eingang in die Preise finden, fördert das die Überproduktion sowie den Konsum hieraus resultierender Nahrungsmittel“, fasst Dr. Tobias Gaugler von der Uni Augsburg zusammen. „Diese Form von Marktversagen lässt außerdem nachhaltig(er) erzeugte Lebensmittel teuer erscheinen und führt letztlich zu einem ökonomischen Wohlfahrtsverlust! Anders gesagt: Aus volkswirtschaftlicher Sicht handelt es sich um eine erhebliche Preis- und Marktverzerrung.“ Auch die Folgen des Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung sind Gegenstand der Studie, unberücksichtigt bleiben Faktoren wie mit der Landwirtschaft verbundene Boden- bzw. Regenwaldverluste, CO2e-Emissionen und der Verlust der Biodiversität. „Daher stellen die hier vorgestellten Größenordnungen lediglich Untergrenzen der aktuell aus der Landwirtschaft resultierenden externen Effekte – und den damit verbundenen, kategoriespezifischen Fehlbepreisungen – dar“, betonen die Wissenschaftler. (ab)
19.09.2016
320.000 Menschen gehen gegen CETA und TTIP auf die Straße

Etwa 320.000 Menschen sind am Samstag in Deutschland gegen die geplanten Handelsabkommen TTIP und CETA und für einen gerechten Welthandel auf die Straßen gegangen. Mit bunten Plakaten und Fahnen, Verkleidungen und Großpuppen, Luftballons und Trillerpfeifen verliehen sie ihrem Protest Ausdruck. Allein in Berlin kamen trotz eines regnerischen Starts nach Angaben der Veranstalter 70.000 Menschen, in Hamburg waren es 65.000. Auch in Köln, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart und München demonstrierten Tausende. „Heute haben 320.000 noch einmal bekräftigt: Die Bundesregierung muss endlich die Notbremse ziehen und das Nein der Bürgerinnen und Bürgerinnen zu CETA und TTIP respektieren“, forderten die Organisatoren, ein breites Bündnis von über 30 Aktivistennetzwerken, Wohlfahrts- und Sozialverbänden, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen, Gewerkschaften, kirchlichen und Entwicklungsorganisationen. „Beide Abkommen schaffen eine konzernfreundliche Paralleljustiz, beide sind eine Gefahr für die Demokratie, für Sozial- und Umweltstandards, die öffentliche Daseinsvorsorge und eine nachhaltige Landwirtschaft, beide müssen gestoppt werden. CETA bedeutet TTIP durch die Hintertür“, verkündete das Bündnis im Anschluss an die Demos. Sie fordern von der Bundesregierung, die Verhandlungen zu TTIP offiziell zu beenden und das bereits ausgehandelte CETA-Abkommen zwischen der EU und Kanada weder zu ratifizieren noch anzuwenden, bevor die nationalen Parlamente darüber abgestimmt haben. Doch nicht nur die Angst vor einer Aushebelung europäischer Umwelt- und Sozialstandards beunruhigt die Menschen, auch die Sorge um die Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft in Deutschland zog viele auf die Straße. Jochen Fritz, Biobauer aus Werder und Sprecher der Demonstrations-Bündnisses „Wir haben es satt!“, warnte auf der Abschlusskundgebung in Berlin, dass TTIP und CETA den Strukturwandel in der Landwirtschaft weiter anheizen werden. „Wenn die Bäuerinnen und Bauern größtenteils weg sind, Chemieriesen über unser Saatgut herrschen, dann ist es zu spät aufzuwachen“, mahnte Fritz auf dem Podium. „Deshalb müssen wir jetzt alle aufwachen und gemeinsam gegen TTIP aufbegehren, denn diese Abkommen haben nur ein Ziel. Die Globalisierung und die Industrialisierung der Landwirtschaft voranzutreiben. Wir Bäuerinnen und Bauern würden auf der Strecke bleiben. Damit gehören diese Abkommen auf den Mist!“, forderte Fritz. Auch Reinhild Benning von der Organisation Germanwatch steht den Freihandelsabkommen kritisch gegenüber. „Durch TTIP und Ceta werden unsere Produkte austauschbar. Die Bauern verlieren an Einfluss und werden durch die stärkere Macht der Konzerne erpressbar“, sagt sie ntv. „Die Politiker täten gut daran, sich von den geplanten Vorhaben zu verabschieden: Wer Bauern quält, wird abgewählt!“. Die Organisatoren hoffen, dass der Protest der Bevölkerung ein deutliches Zeichen an das Treffen der EU-Handelsminister in Bratislava am 23. September senden wird sowie an den am Montag tagenden SPD-Parteikonvent, bei dem Sigmar Gabriel CETA inklusive einer vorläufigen Anwendung des Abkommens abnicken lassen will. (ab)
15.09.2016
NGOs fordern Stopp der Fusion von Bayer und Monsanto

Entwicklungspolitische Organisationen und Umweltverbände haben mit Entsetzen auf die Nachricht einer Übernahme von Monsanto durch Bayer reagiert und ein Verbot des Zusammenschlusses gefordert. Sie fürchten eine weitere Konzentration des Saatgut- und Pestizidmarktes und negative Auswirkungen für Bauern und die Umwelt. Die beiden Konzerne hatten am Mittwoch die Unterzeichnung einer verbindlichen Fusionsvereinbarung bekannt gegeben: Der deutsche Chemiegigant übernimmt den US-Saatgutkonzern für 128 US-Dollar je Aktie in bar, der Preis liegt damit bei rund 66 Milliarden US-Dollar. Der neue Konzern würde zur weltweiten Nummer 1 im Saatgut- und Agrarchemiegeschäft aufsteigen. Die Vorteile der Fusion für Landwirte liegen laut Bayer und Monsanto „in einem umfassenden Angebot an Lösungen für den heutigen wie den künftigen Bedarf – einschließlich besserer Lösungen bei hochwertigem Saatgut, Pflanzeneigenschaften, digitaler Landwirtschaft und Pflanzenschutz.“ Dass diese Lösungen für Bauern und Bäuerinnen weltweit von Vorteil sind bezweifeln jedoch die entwicklungspolitischen Organisationen MISEREOR, FIAN Deutschland, INKOTA und Brot für die Welt. „Mit Saatgut von Bayer und Monsanto lässt sich keine zukunftsfähige Landwirtschaft betreiben. Beide Konzerne produzieren genmanipuliertes Saatgut und die korrespondierenden Pestizide, die sie dann im „Kombi-Pack“ verkaufen“, erklärt FIAN-Agrar-Referent Roman Herre. „Wir dürfen die Welternährung nicht in die Hände eines Agro-Oligopols legen und damit das Menschenrecht auf Nahrung in Gefahr bringen“, warnt Herre. Statt Gift und Gentechnik bedürfe es politischer Rahmenbedingungen, die es Bauern und Bäuerinnen ermöglichen, frei und unabhängig über ihr Saatgut zu bestimmen. Die Organisation beklagen die zunehmende Markt- und Machkonzentration bei Saatgut und Pestiziden. Bereits heute kontrollieren allein sechs Konzerne gut 75% des globalen Agrarchemiemarktes, bei Saatgut sind es mehr als 60%. Doch die Elefantenhochzeit zwischen Bayer und Monsanto ist nicht der einzige anstehende Megadeal: Auch Dow und DuPont kündigten 2015 einen 130 US-Dollar schweren Zusammenschluss an, ChemChina will sich den Schweizer Agrarkonzern Syngenta einverleiben und erhielt dafür schon von einer entscheidenden US-Behörde Ende August grünes Licht. „Die Folgen der Fusionen wären fatal: drei Saatgutkonzerne kontrollierten dann größtenteils unser Saatgut und damit die Lebensgrundlagen für die Ernährung der Menschheit“, warnt Sarah Schneider, Referentin für Landwirtschaft und Ernährung bei MISEREOR. „Die Preise für Saatgut würden steigen, und die Wahlfreiheit bei Saatgut und Pestiziden würde noch stärker eingeschränkt. Insbesondere Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in den armen Regionen der Welt wären davon massiv betroffen.“ Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland teilt diese Bedenken: „Der neue Konzern würde künftig verstärkt diktieren wollen, was Landwirte anbauen und welche Produkte auf dem Markt verfügbar sind. Auch die Umwelt würde durch noch mehr Monokulturen und weitere Gentechpflanzen leiden“, so Gentechnikexpertin Heike Moldenhauer. „Diese Übermacht darf die EU nicht hinnehmen“, fordert auch der agrarpolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Martin Häusling. „Deshalb sind jetzt die deutschen Aufsichtsbehörden und die europäischen Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gefragt. Sie müssen verhindern, dass Bayer den weltweiten Agrarchemiemarkt dominieren kann.“ Doch nicht nur in Europa ist nach der Fusions-Ankündigung der Aufschrei groß: „Unsere internationalen Partnerorganisationen haben sofort nach den ersten Übernahmegerüchten angekündigt, in ihren Ländern alle juristischen Mittel auszuschöpfen, um einen neuen Mega-Konzern Bayer-Monsanto zu verhindern“, sagte Stig Tanzmann, Agrarexperte von Brot für die Welt. (ab)
- PM: Entwicklungspolitische Organisationen fordern Stopp der Giganten-Hochzeit
- Bayer: Bayer und Monsanto schaffen ein weltweit führendes Unternehmen der Agrarwirtschaft
- BUND warnt vor marktbeherrschender Stellung auf dem Gentechnik- und Pestizid-Markt
- Martin Häusling: EU muss Bayers Monsanto-Deal stoppen
12.09.2016
Weltweit größte Sammlung seltener Schafrassen steht vor dem Aus

Die Schließung des Seven Sisters Sheep Centre in East Dean bedeutet nicht nur das Aus für einen weiteren kleinen Hof in Südengland, sondern besiegelt auch das Ende der größten Sammlung seltener, britischer Schafrassen. Die Schaffarm in den beschaulichen Hügeln der South Downs zwischen Eastbourne und Seaford beherbergte einst 57 der 63 einheimischen Schafrassen des Königreichs und ist damit die größte private Sammlung weltweit – oder wie Besitzer Terry Wigmore es ausdrückt: „Zumindest hat keiner jemals behauptet, mehr verschiedene Schafrassen zu besitzen.“ Doch nun verabschieden sich Terry und seine Frau Pam nach 29 Jahren in den Ruhestand und die Herde wird verstreut. Sie hatten sich lange bemüht, einen Abnehmer für die gesamte Sammlung zu finden – doch leider vergeblich. Anfang Oktober kommen nun die über 500 Tiere unter den Hammer, darunter vom Aussterben bedrohte Schafrassen wie das Dorset Horn, Teeswater oder Manx Loaghtan. Aber auch einige Mangalitza-Schweine und Alpakas benötigen ein neues Dach über dem Kopf. Den Wigmores war schon früh bewusst, dass sie allein mit Wolle und Schafmilch ihren Lebensunterhalt auf Dauer nicht verdienen können. Die seltenen Rassen sind nicht wirtschaftlich, da sie nicht konkurrenzfähig mit der modernen Tierhaltung sind, erklärt Terry. Mit der Internationalisierung der Märkte sind die Herden auf eine kleinere Anzahl optimierter Schafrassen mit magererem Fleisch zusammengeschrumpft, die mit weniger Futter schneller wachsen, beklagt der passionierte Schafsammler. Doch die unzähligen Besucher, die jedes Jahr zur Lammzeit am Gatter standen und auf den Weiden nach Osterlämmern Ausschau hielten, brachten ihn auf die Idee, an die Farm ein Besucherzentrum anzugliedern. Tagsüber dürfen die Besucher nun für ein paar Stunden die Schafe streicheln, füttern, den verstoßenen Lämmern das Fläschchen geben oder Terry beim Scheren zusehen. Die übrige Zeit verbringen die Schafe auf der Weide. „Es war wichtig für uns, den Menschen zu ermöglichen, die Tiere zu berühren und zu füttern, doch Gesundheits- und Sicherheitsauflagen haben es jedes Jahr schwieriger gemacht, dies aufrechtzuerhalten“, berichtet Terry. Mit der Schließung am 4. September geht nun nicht nur eine Touristenattraktion verloren, sondern möglicherweise auch ein reicher Schatz an seltenen Tierrassen, deren genetische Eigenschaften künftig von großer Bedeutung sein könnten. Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO sind weltweit 1.458 landwirtschaftlich genutzte Tierrassen vom Aussterben bedroht - gut 17% aller Nutztierrassen. Aufgrund der schlechten Datenlage ist zudem bei fast 60% der Nutztierrassen unklar, wie es um ihren Erhaltungszustand bestellt ist. Alleine in den Jahren zwischen 2000 und 2014 sind 100 Tierrassen verschwunden. Als Gründe für die zunehmende Verringerung der genetischen Vielfalt nennt die FAO wahllose Kreuzungen, den wachsenden Einsatz nicht heimischer Tierarten, den Rückgang traditioneller Produktionsformen sowie die Vernachlässigung von Rassen, die nicht als leistungsfähig genug gelten. Oder deren Fleisch als zu fett gilt. Dies mag auch zum Rückgang der Southdowns geführt haben, eine für die Gegend von Terrys Schaffarm typische Rasse mit dickem Pelz. In den 50er und 60er-Jahren grasten noch 25.000 Exemplare in den South Downs zwischen Eastbourne und Brighton - nun gibt es in ganz Großbritannien noch 900 Southdowns. Dabei könnten seltene Rassen gerade in Zeiten des Klimawandels für die Welternährung enorm an Bedeutung gewinnen, da sie genetische Eigenschaften mitbringen wie Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an veränderte klimatische Bedingungen. Ein Beispiel in Terrys Sammlung ist das Wensleydale. Aufgrund der charakteristischen blaugrauen Hautfarbe ist diese Schafrasse auch für ein heißes Klima bestens ausgerüstet. Daher ist es entscheidend, diese seltenen Nutztierrassen zu schützen und vor dem Aussterben zu bewahren, bevor es zu spät ist. (ab)
08.09.2016
Klimaschutzplan im Bereich Landwirtschaft und Ernährung verwässert

Das Bundesumweltministerium (BMUB) hat einen um konkrete Ziele beraubten und in puncto Landwirtschaft und Ernährung verwässerten Klimaschutzplan 2050 vorgelegt. Der Entwurf vom 6. September soll als Basis zur offiziellen Abstimmung innerhalb der Bundesregierung dienen, doch schon im Vorfeld wurden durch SPD-Chef Sigmar Gabriel und auf Drängen des Kanzleramtes konkrete Ziele gestrichen, wie Umweltministerin Barbara Hendricks einräumte. Mit dem Plan will Deutschland den Klimavertrag von Paris umsetzen und den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 im Vergleich zu 1990 um 80 bis 95% verringern. Doch damit die deutsche Industrie nicht darunter leidet, hatte das Kanzleramt gerade in den Bereichen Verkehr, Kohleausstieg und Landwirtschaft kräftig gestrichen. Eine neue Präambel betont, die Bundesregierung werde „ein zentrales Augenmerk auf den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft“ legen. Die Halbierung landwirtschaftlicher Treibhausgasemissionen von heute bis 2050 steht zwar weiterhin im Papier, doch konkrete Maßnahmen und Zahlen zur Erreichung dieses Ziels wurden gestrichen. „Bis 2030 sollten die Stickstoffüberschüsse durch weitere Maßnahmen auf 50 kg Stickstoff je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche gesenkt werden“, war in der Fassung vom 21. Juni noch zu lesen. Nun prangt dort xxx statt klaren Zahlen. Wollte das BMUB einst Exportbeschränkung für tierische Produkte und eine Abstockung der Tierbestände, ist jetzt von „Verringerung der Emissionen aus der Tierhaltung“ die Rede. „Inwieweit Exportüberschüsse zum Abbau der Tierbestände abgebaut werden können“, will die Bundesregierung noch „prüfen“. Umweltverbände übten herbe Kritik an dem unambitionierten Entwurf. „Anstatt die Tierhaltung zurückzufahren und Fleisch nicht mehr in Massen für den Export zu produzieren, drückt sich die Bundesregierung vor wirksamen Klimaschutzmaßnahmen im Agrarsektor. Erforderlich ist ein konsequenter Umbau der Tierhaltung hin zu deutlich mehr Weidetierhaltung nach ökologischen Standards“, kommentierte der Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Hubert Weiger. Überlebt hat bisher noch die Flächenbindung der Tierhaltung. Mittelfristig soll zudem „in Regionen mit intensiver Tierhaltung ab Tierbesatzdichten von mehr als 2 Großvieheinheiten je Hektar keine Genehmigung für den Bau neuer Tierställe erfolgen“. Komplett löschen musste das BMUB die Reduzierung des Fleischkonsums. „Bis 2050 sollte ein Fleischkonsum entsprechend der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung angestrebt werden“, stand da einst, was zur „erheblichen Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und zur Verringerung der Kosten im Gesundheitswesen führen [würde], da ein hoher Fleischkonsum ernährungsbedingte Krankheits-Risiken hervorruft.“ Die DGE empfiehlt 300-600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche, doch die Deutschen vertilgen mit rund 60 Kilo Fleisch im Jahr deutlich mehr als ein Kilo wöchentlich. „Ich habe diese Änderungen akzeptiert, damit die notwendigen Gespräche in der Bundesregierung nicht noch länger hinausgezögert werden“, rechtfertigte Hendricks. Der Klimaschutzplan soll noch vor der Wahl 2017 verabschiedet werden. Die Grünen bezeichneten es als „Armutszeugnis der Bundesregierung, wenn kaum noch eine substanzielle Maßnahme für den Klimaschutz im Klimaschutzplan stehen bleibt“. Auch der BUND warnt vor einem Scheitern: „Die Bundesregierung muss endlich eine Klimapolitik auf den Weg bringen, die künftigen Generationen Rechnung trägt. Tut sie das nicht, dokumentiert der Klimaschutzplan 2050 vor allem ihr historisches Versagen“, so Weiger. (ab)
- top agrar online: Kanzleramt entlastet Landwirtschaft beim Klimaschutzplan
- Pressemitteilung BUND: Klimaschutzplan 2050 grenzt an Realitätsverweigerung
- DW.com: Geringer Fleischkonsum aus Klimaschutzplan gestrichen
- Klimaschutzplan in der Fassung vom 6. September
- Klimaschutzplan in der Fassung vom 21. Juni
05.09.2016
Klimafreundlicher Konsum: Agrarbeiräte fordern höhere Fleischsteuer

Deutschland kann seine Klimaschutzziele nur erreichen, wenn auch die Landwirtschaft und das Konsumverhalten der Bevölkerung klimafreundlicher werden. Daher fordern zwei Expertenbeiräte der Regierung nun unter anderem die Reduzierung des Fleischkonsums sowie die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes für tierische Produkte. Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz und der Beirat für Waldpolitik des Landwirtschaftsministeriums haben auf mehr als 400 Seiten Empfehlungen für einen wirksamen Klimaschutz in der Land-, Forst- und Holzwirtschaft sowie im Ernährungsbereich zusammengetragen. Den Experten zufolge entfielen 2014 mit 104 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten rund 11% der Emissionen in Deutschland auf die Landwirtschaft. Werden die Emissionen einbezogen, die bei der Herstellung, Vermarktung und Zubereitung der bundesweit verzehrten oder weggeworfenen Lebensmittel entstehen, verursachen Landwirtschaft und Ernährung ein Viertel der Emission. Wenn Deutschland und die EU also bis 2050 gut 80 bis 95% des Treibhausgas-Ausstoßes im Vergleich zu 1990 verringern wollen, besteht hier Handlungsbedarf, so die Wissenschaftler. Um zu vermeiden, dass die Produktion klimaschädlicher Lebensmittel und damit der CO2-Ausstoß ins Ausland verlagert werden, sei die Umstellung des Konsums auf klimafreundlichere Lebensmittel notwendig. „Die Beiräte sehen daher eine Reduzierung des Verzehrs tierischer Produkte bei denjenigen Personen, deren Verbrauch dieser Produkte über den ernährungswissenschaftlich basierten Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegt, als wichtige Stellschraube zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen an“, schreiben die Experten. Die höchsten Emissionen je Kilogramm verursachen dem Gutachten zufolge Butter, Rindfleisch, Käse und Quark, Schweine- sowie Geflügelfleisch, während pflanzliche Lebensmittel pro Kalorie bzw. pro Gramm Protein besser abschneiden. Gemäß den Empfehlungen der DGE sollte der Verzehr von Fleisch- und Fleischprodukten für gesunde Erwachsene bei nicht mehr als 600 Gramm pro Woche liegen. Doch das kümmert gerade die Männer hierzulande recht wenig. Im Schnitt vertilgen sie derzeit wöchentlich 1,1 Kilogramm Fleisch und Wurst, die Frauen kommen auf 600 Gramm. Würde die Bevölkerung zur Einhaltung der DGE-Empfehlungen bewegt, ließen sich im Jahr 22,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Zur Erreichung dieses Ziels empfehlen die Beiräte neben Informationskampagnen die Belegung tierischer Produkte mit dem vollen Mehrwertsteuersatz von 19% statt dem aktuell angewandten reduzierten Satz von 7%. Um negative Auswirkungen auf ärmere Bevölkerungsteile abzupuffern, seien flankierende sozialpolitische Maßnahmen erforderlich, z. B. die Anpassung des für Lebensmittel angesetzten Budgets im Rahmen sozialer Transferleistungen. Die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung soll nach Ansicht der Beiräte eine Vorreiterrolle einnehmen: In Kitas und Schulen etwa soll mehr Gemüse statt Fleisch auf die Teller kommen. Das zweitgrößte Treibhausgas-Minderungspotenzial sieht das Gutachten in der Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Verbraucher sollten verstärkt darüber aufgeklärt werden, dass es sich beim Mindesthaltbarkeitsdatum nicht um ein Verfallsdatum handelt. Als weitere auf einen klimafreundlicheren Konsum abzielende Maßnahmen nennen die Beiräte das Ersetzen von Mineralwasser durch Leitungswasser und eine starke Verringerung des Konsums von mit dem Flugzeug importierten Lebensmitteln. Doch nicht nur die Verbraucher sollen in die Pflicht genommen werden. Eine Verschärfung des Düngerechts und die Einführung einer Abgabe, wenn Stickstoff-Überschüsse nicht hinreichend reduziert werden, lautet ein Vorschlag. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, dem das Gutachten am Freitag in Berlin überreicht wurde, kündigte an, sein Ministerium werde das Papier intensiv prüfen. (ab)
23.08.2016
Adios Monsanto: Gentechnik-Saatgutfabrik in Argentinien gestoppt

Zu viel Widerstand, zu geringe Profitaussichten: Der US-Agrarriese Monsanto hat den Bau einer Fabrik für gentechnisch verändertes Maissaatgut in der argentinischen Provinz Córdoba scheinbar aufgegeben. Wie argentinischen Medien Anfang August berichteten, wurden Bauteile und Maschinen bereits vom Gelände in der Kleinstadt Malvinas Argentinas abgezogen. Seit September 2013 hatten Aktivisten die Zufahrtswege zu dem Gelände blockiert, um den Bau der Anlage zu verhindern. Eine offizielle Stellungnahme von Monsanto zu den Abzugsplänen steht noch aus, doch ein nicht namentlich genannter Monsanto-Mitarbeiter bestätigte gegenüber der Zeitung iProfesional den Rückzug. Als Grund führte er wirtschaftliche Motive mit Blick auf aktuelle Anbauentwicklungen in der argentinischen Landwirtschaft an. „Die Anlage war darauf ausgerichtet, Saatgut im Umfang von 3,5 Millionen Hektar Mais aufzubereiten, im letzten Jahr wurden aber kaum mehr als 2,5 Millionen angebaut. Eine derartige Investition ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll.“ Monsanto könne die Nachfrage auch mit dem bereits bestehenden Werk in Rojas in der Provinz Buenos Aires bedienen. „Wie die Dinge momentan stehen, reicht dieses Werk allein vermutlich für die nächsten fünf Jahre aus“, zitierte iProfesional den Mitarbeiter. Dieser räumte auch ein, dass der jahrelange Widerstand von Bewohnern und Umweltschützern, durch den das Bauvorhaben zum Erliegen gekommen war, da notwendige Materialien fehlten, ebenfalls zum Investitionsstopp beigetragen hatte. Trotz Räumungsversuchen hatten die Aktivisten vor dem Grundstück gecampt. Im Januar 2014 verfügte ein Gericht der Provinz Córdoba dann einen Baustopp, da keine ausreichende Umweltverträglichkeitsstudie für die Anlage vorlag und keine öffentliche Anhörung stattgefunden hatte. „Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Das Unternehmen hätte schon längst diese Entscheidung zu gehen treffen sollen“, erklärte Vanesa Sartori von der Protestvereinigung Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. „Wir werden jedoch weiter wachsam sein und aus der Nähe beobachten, wie der Ausgang dieser Geschichte sein wird bis Monsanto die letzte Schraube vom Gelände entfernt hat und endgültig verschwunden ist“, kündigte Sartori an. Auch Sofia Gatica, die federführend an dem Protest beteiligt war, zeigte sich erleichtert. „Seit drei Jahren sind wir hier, morgens, nachmittags, abends, uns war kalt und wir hatten Hunger, es gab kein Licht und keine Toiletten. Wir haben hier unzählige Menschen aus allen Himmelsrichtungen im Camp versammelt. Ehen sind daran zerbrochen, da unsere Ehepartner uns vor die Wahl stellten: entweder Monsanto oder ich.“ Doch die Gentechnik-Gegner harrten aus. Sogar Kinder seien im Protestcamp zur Welt gekommen. Nun scheint Monsanto also Malvinas den Rücken zu kehren. „Wenn sich der Widerstand von unten regt, bringt das die oben zu Fall. Die Bevölkerung hat es hier geschafft“, sagte Sofía Gatica dem lokalen Nachrichtensender CBA24n. (ab)
22.08.2016
Intensivierung der Landwirtschaft setzt Europas Feldvögeln zu

Europas Feldvögel leiden unter der Intensivierung der Landwirtschaft - doch Naturschutzmaßnahmen allein werden ins Leere laufen, wenn nicht auch die EU-Agrarpolitik grundlegend auf die Bewahrung der Biodiversität ausgerichtet wird. Dies ist das Fazit einer neuen Studie von acht Forschungseinrichtungen und Verbänden, die in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Conservation Letters veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftler untersuchten den Zusammenhang zwischen dem seit Jahren zu verzeichnenden Rückgang der Feldvögelbestände in Europa und der Naturschutz- und Agrarpolitik der Europäischen Union. Ihr Augenmerk galt 39 EU-weit vorkommenden Feldvogelarten und deren Entwicklung von 1981 bis 2012. Die Studie zeigte zwar, dass Naturschutzinstrumente und Agrarumweltprogrammen der EU einen wichtigen Beitrag zum Erhalt vieler Vogelarten auf Feldern und Wiesen leisten, zum Beispiel durch die Ausweisung von Vogelschutzgebieten oder die Zuweisung eines hohen Schutzstatus für einzelne Arten durch die EU-Vogelschutzrichtlinie. Doch diese Maßnahmen reichen den Forschern zufolge nicht aus, um den dramatischen Artenschwund zu bremsen, da ihre Wirkung durch eine immer intensiver werdende Landwirtschaft ausgehebelt wird – ein Trend, der durch die EU-Agrarförderung weiter verstärkt wird. „Wieder einmal halten wir einen eindringlichen Beleg in Händen: Die EU setzt mit ihrer Agrarpolitik des "Immer mehr und immer größer" die falschen Signale“, erklärte NABU-Präsident Olaf Tschimpke. „Europa braucht dringend einen Richtungswechsel, hin zu einer Agrarpolitik, die Naturschutzleistungen der Landwirte fördert und angemessen honoriert“, forderte der Verband in einer Pressemitteilung. „Solange die EU ihre Agrarpolitik nicht ändert, werden ihre Anstrengungen zum Naturschutz mitunter verpuffen. Die EU muss dringend dafür sorgen, dass die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft nicht unter die Räder kommt“, so Tschimpke weiter. Auch in Deutschland ist es um die Feldvögel schlecht bestellt. Die Bestände fast aller Feldvogelarten sind stark geschrumpft in den letzten Jahren. Nach Angaben des NABU sind seit 1990 sind ein Drittel der Feldlerchen, 75 Prozent der Kiebitze und 94 Prozent der Rebhühner verschwunden. (ab)