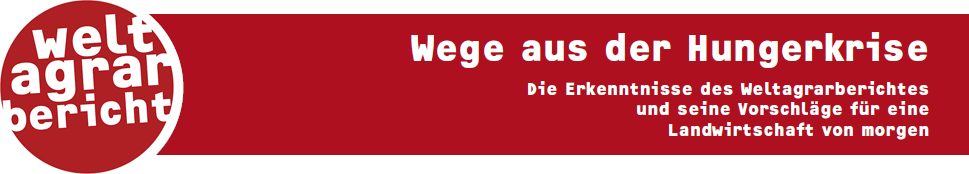Nachrichten
17.02.2016
Studie: Kluges Wassermanagement kann Klimafolgen abfedern und Erträge steigern

Besseres Wassermanagement in der Landwirtschaft könnte helfen, mehr Nahrung mit der gleichen Menge Wasser zu produzieren und die Folgen des Klimawandels abzumildern. Das zeigt eine neue Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), die im Fachmagazin Environmental Research Letters erschienen ist. Die Wissenschaftler untersuchten, inwiefern durch die Nutzung von Regenwasser und Investitionen in eine optimierte Bewässerung von Agrarflächen die Lebensmittelproduktion gesteigert werden kann. „Intelligente Wassernutzung kann die landwirtschaftliche Produktion ankurbeln – wir waren erstaunt, auf globaler Ebene solch beträchtliche Effekte zu sehen“, sagt Leitautor Jonas Jägermeyr vom PIK. Ein ambitioniertes Wassermanagement könnte die weltweite Kilokalorien-Produktion um 41% steigern, zeigt ein Szenario. Die Forscher äußern sich zuversichtlich, dass diese Steigerungen die Unterernährung bis 2050 reduzieren könnten, da die bis dahin zu schließende Ertragslücke zwischen der Lebensmittelproduktion und dem Bedarf einer wachsenden Weltbevölkerung so halbiert werden könne. Auch wenn die Studie die viel zitierten Zahlen zur Ertragslücke nicht hinterfragt – bereits heute produziert die Landwirtschaft UN-Zahlen zufolge genug Kalorien, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren – oder erklären, wie die Hungernden allein durch einen Produktionszuwachs Zugang zu Nahrung erhalten sollen, zeigt sie die enormen Chancen einer klügeren Wassernutzung auf. „Es zeigt sich, dass landwirtschaftliches Wassermanagement ein bislang vielfach unterbewerteter Ansatz zur Minderung von Unterernährung in kleinbäuerlichen Betrieben ist und zur Steigerung ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Auswirkungen des Klimawandels“, so Jägermeyr. Für ihre Studie analysierten die Wissenschaftler Low-Tech-Lösungen für Kleinbauern, aber auch ein besseres Wassermanagement in der industriellen Bewässerung. So sei das Auffangen überschüssigen Regenwassers für die Bewässerung in Trockenperioden z.B. in der Sahelzone Afrikas eine gängige Praxis, werde aber in vielen anderen halbtrockenen Regionen etwa in Asien oder Nordamerika noch nicht genutzt. Auch die Tröpfchenbewässerung zum gezielten Einsatz von Wasser sei vielerorts ausbaufähig. Großes Einsparpotenzial biete auch das Mulchen, da durch das Bedecken der Böden mit Ernteresten vom Feld oder auch durch Planen die Verdunstung verringert werden könne. Das größte Potenzial zur Steigerungen der Ernteerträge durch bessere Wassernutzung bestehe vor allem in wasserarmen Regionen wie in China, Australien, dem Westen der USA, Mexiko und Südafrika. Die Autoren betonen, dass mit Blick auf den Klimawandel ein besseres Wassermanagement immer wichtiger werde, um Ertragseinbußen durch häufiger auftretende Dürre und veränderte Niederschlagsmuster zu verhindern. Ko-Autor Johan Rockström vom Stockholm Resilience Centre wies zudem auf die Bedeutung eines verbesserten Wassermanagement und fundiertem Erkenntnisse dazu für das Erreichen der SDGs hin: „Die kürzlich verabschiedeten erneuerten Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die eine nachhaltige Landwirtschaft einfordern, brauchen Belege, wie die Ziele tatsächlich zu erreichen sind, und Wasser ist hierbei ungeheuer wichtig. Da wir rasch an planetare Grenzen stoßen, sollte unsere Studie die Aufmerksamkeit von Entscheidungsträgern auf allen Ebenen auf das Potenzial von verbessertem landwirtschaftlichen Wassermanagement lenken.“ (ab)
15.02.2016
Studie: „Grüne Revolution“ für Afrika könnte Armut unter Kleinbauern verstärken

Programme und Agrarpolitiken zur Förderung einer „Grünen Revolution“ in Afrika, die offiziell die Armutsbekämpfung zum Ziel haben, könnten genau das Gegenteil bewirken. Eine Studie, die im Februar im Fachmagazin „World Development” erschien, kam zu dem Ergebnis, dass das Aufoktroyieren „moderner“ landwirtschaftlicher Praktiken in ländlichen Gemeinden in Subsahara-Afrika dazu beitragen kann, Landverlust, Armut, Ernährungsunsicherheit und Ungleichheit zu verstärken. Forscher der Universität von East Anglia untersuchten am Beispiel Ruanda die Agrarpolitik sowie Veränderungen, die Landbewohner in acht Gemeinden im bergigen Westen erfuhren, wo Kleinbauern auf kleinen Flächen Subsistenzlandwirtschaft betrieben und eine Vielfalt an Kulturen anbauten. Laut der Studie verfolgte Ruanda mit seiner Landpolitik und dem „Crop Intensification Program” einen raschen Übergang von traditionellen Anbaumethoden hin zu einer Spezialisierung auf einige wenige, leicht verkäufliche Getreidesorten und Cash Crops sowie die Bereitstellung von verbessertem Saatgut, Mineraldünger und Krediten. Diese Programme wurden von der Regierung, dem Internationalen Währungsfonds und anderen internationalen Geldgebern als Erfolg verkauft, da insgesamt in dem Zeitraum die Erträge stiegen und die Armut im Land abnahm. Doch Dr. Neil Dawson und sein Team kritisieren, dass die negativen Folgen der Agrarpolitik für die ärmeren Bauern und die Sichtweise der Landbevölkerung selbst missachtet wurden. Die Studie belegt, dass nur eine relativ kleine, wohlhabende Minderheit mit der erzwungenen Modernisierung mithalten konnte, da für die ärmsten Bauern das Risiko der Kreditaufnahme für teuere Inputs wie Dünger und Saatgut zu hoch war. „Andere Experimente in Afrika fördern ähnliche Ergebnisse zutage. Landwirtschaftliche Entwicklung hat das Potenzial, den Menschen zu helfen, doch diese Politiken scheinen Landverlust und Ungleichheit unter der armen Landbevölkerung zu verschärfen“, sagte Dr. Dawson. „Diese Politiken mögen die Gesamtproduktion exportierbarer Feldfrüchte steigern, doch vielen der ärmeren Kleinbauern entziehen sie ihre wichtigste produktive Ressource: Land.“ Dr. Dawson bezeichnet es als alarmierend, dass Politiken und Programme mit derart weitreichenden Folgen für die arme Bevölkerung allgemein so unangemessen überprüft würden. Den Autoren zufolge sind die Bedingungen in afrikanischen Ländern heute anders als noch vor 40 Jahren, als die Grüne Revolution in Asien Erfolge verbuchen konnte. Dennoch würden die Gates-Stiftung oder Initiativen wie die “New Alliance for Food Security and Nutrition” oder Konzerne wie Monsanto weiterhin eine landwirtschaftliche „Modernisierung“ in Afrika vorantreiben, obwohl oft unklar sei, ob sich dadurch die Lebensumstände von Kleinbauern verbessern. Die Studienautoren fordern daher, diese Initiativen umfassenderen und strengeren Folgenabschätzungen zu unterziehen. Politiken und Programme müssten zudem Maßnahmen enthalten, die eine Verstärkung der Armut verhindern. Im Falle Ruandas sei es notwendig, dass vor allem die arme Bevölkerung Zugang zu Land erhalte und traditionelle Anbaupraktiken unterstützt würden, während eine „Modernisierung“ nur schrittweise und freiwillig erfolgen dürfe. (ab)
11.02.2016
Fleisch in Massen – deutsche Schlachtmenge erreicht neuen Rekordwert

Im Jahr 2015 wurde in Deutschland so viel geschlachtet wie noch nie: Die Fleischproduktion erreichte einen Rekordwert von 8,22 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit stieg die gewerblich erzeugte Gesamtschlachtmenge gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,3% und übertraf das bisherige Rekordjahr 2011. „Dieser Rekord ist kein Zeichen von Wohlstand, sondern ein Armutszeugnis“, kritisierte die Umweltorganisation Greenpeace Medienberichten zufolge. Deutschland erzeuge mit großem Energieaufwand, Futterimporten aus Übersee und Massentierhaltung gewaltige Überschüsse, um sie auf dem Weltmarkt anzubieten. Denn diese Unmengen an Fleisch können nicht einmal die für ihren hohen Fleischkonsum bekannten Bundesbürger vertilgen: Nach Angaben des Deutschen Fleischer-Verbands betrug der Selbstversorgungsgrad 2014 bei Schweinefleisch 117%, zudem wurde 13% mehr Geflügel und 11% mehr Rindfleisch erzeugt, als im Land verbraucht wurde. Zuletzt ließ der deutsche Fleischhunger sogar etwas nach. 2014 sank der Pro-Kopf-Verzehr laut Fleischerverband leicht auf 60,3 Kilogramm, 2010 wurde noch ein ganzes Kilo mehr gegessen. Aufgrund des Produktionsüberschusses exportieren daher viele Schlachtbetriebe verstärkt ins Ausland. Für 2014 beziffert der Deutsche Fleischer-Verband den Ausfuhrüberschuss Deutschlands auf 1,5 Millionen Tonnen Fleisch. Mehr als drei Viertel davon gingen in andere Länder der EU, doch gerade auch China nimmt immer mehr Schweinfleisch ab. In den ersten drei Quartalen 2015 gingen 17,7% der Schweinefleischexporte in die Volksrepublik, ein Plus von 53% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Hinblick auf die aktuellen Schlachtzahlen vermeldet das Statistische Bundesamt eine leichter Änderung des Anteils der jeweiligen Fleischarten in den letzten vier Jahren: Mit insgesamt 59,3 Millionen geschlachteten Schweinen im Jahr 2015 macht Schweinefleisch an der Gesamtschlachtmenge nun 67,6 % aus, während es 2011 noch 68,2 % waren. Die Geflügelfleischerzeugung stieg dagegen überproportional an, von 17,3% in 2011 auf 18,4 % im vergangenen Jahr: 2015 wurden 1,52 Millionen Tonnen Geflügel produziert. Der Anteil von Rindfleisch verringerte sich hingegen leicht auf 13,6%: 3,5 Millionen Rinder wurden geschlachtet beziehungsweise 1,1 Millionen Tonnen Rindfleisch erzeugt. (ab)
- Destatis: Fleischerzeugung im Jahr 2015 mit neuem Rekordwert
- Süddeutsche.de: Fleisch: Deutschland schlachtet mehr als je zuvor
- FOCUS Online: Deutsche Fleischproduktion erreicht Rekord
- Fleischwirtschaft.de: Fleischexporte: Deutschland sucht das China-Schwein
- Deutscher Fleischer-Verband: Geschäftsbericht 2014/2015
09.02.2016
Frankreich verbietet Supermärkten das Wegwerfen von Lebensmitteln

Frankreich hat der Lebensmittelverschwendung durch Supermärkte nun per Gesetz einen Riegel vorgeschoben. Supermärkte dürfen nun keine unverkauften Lebensmittel mehr wegwerfen, sondern müssen diese zum Beispiel an Tafeln spenden. Der französische Senat verabschiedete am Mittwoch einstimmig das Gesetz, das im letzten Jahr bereits von der Nationalversammlung abgesegnet worden war. Das Gesetz verbietet Supermärkten mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern, nicht verkaufte aber noch genießbare Lebensmittel wegzuwerfen oder zu zerstören. Stattdessen müssen die Märkte Spendenvereinbarungen mit Hilfsorganisationen oder Tafeln unterzeichnen. Verstöße sollen mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 75.000 Euro oder zwei Jahren Gefängnis geahndet werden. Nicht mehr für den Verzehr geeignete Lebensmittel sollen als Tierfutter oder in Biogasanlagen Verwendung finden, verarbeitet oder kompostiert werden. Lebensmittel, die optische Makel aufwiesen oder sich dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums näherten, waren bisher sogar von einigen Supermärkten mit Chlorbleiche übergossen worden, um Obdachlose am Durchsuchen der Müllcontainer zu hindern. Zahlreiche Organisationen und Engagierte im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung begrüßten das Gesetz. Jacques Bailet, Leiter von Banques Alimentaires, einem Netzwerk französischer Tafeln, sagte dem Guardian, das Gesetz sei „positiv und aus symbolischer Sicht sehr bedeutend“. Er ist zuversichtlich, dass die Tafeln aufgrund der von Supermärkten zu schließenden Vereinbarungen die Qualität und Vielfalt der Essensspenden erhöhen können. Mit dem Gesetz will Frankreich bis 2025 die Lebensmittelverschwendung halbieren, die das Land jedes Jahr bis zu 20 Milliarden Euro und einen durchschnittlichen Haushalt 400 Euro kostet – ganz zu schweigen von den verschwendeten Ressourcen, die für die Herstellung der Lebensmittel benötigt wurden. Bis zu 7,1 Millionen Tonnen Lebensmittel landen offiziellen Schätzungen zufolge in Frankreich jedes Jahr im Müll – nicht nur von Supermärkten, sondern auch in der Gastronomie und privaten Haushalten. Dazu kommen eine Unmenge an Agrarerzeugnissen, die es gar nicht erst in den Handel schaffen. Viele Organisationen und „Lebensmittelretter“ hoffen nun, dass andere EU-Mitgliedsstaaten dem Vorbild Frankreichs folgen und ähnliche Gesetze verabschieden werden. Doch aus Deutschland kam zunächst eine Abfuhr: „Die Bundesregierung plant so ein Verbot nicht“, zitierte ntv einen Sprecher des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die meisten Geschäfte in Deutschland gäben überflüssige Produkte ohnehin schon an Tafeln oder andere soziale Einrichtungen weiter. (ab)
05.02.2016
Vergleichsstudie: Ökolandbau kann die Welt nachhaltiger ernähren

Der Ökolandbau kann nicht nur mit den Erträgen der konventionellen Landwirtschaft mithalten, sondern schneidet bei Dürre deutlich besser ab und zahlt sich für Landwirte in finanzieller und gesundheitlicher Sicht sowie für die Umwelt aus. Das ist das Fazit einer im Fachmagazin „Nature Plants” erschienenen Metaanalyse, für die Forscher der Washington State University Studien der letzten 40 Jahre auswerteten. Die Wissenschaftler verglichen Erkenntnisse zu ökologischen und konventionellen Produktionssystemen unter vier Gesichtspunkten, die für sie eine nachhaltige Lebensmittelproduktion kennzeichnen: Produktivität, Umweltfreundlichkeit, wirtschaftliche Rentabilität und soziales Wohlergehen. „Vor 30 Jahren gab es gerade einmal eine Handvoll Studien, die die ökologische und konventionelle Landwirtschaft verglichen“, erklärt Hauptautor John Reganold, Professor für Bodenkunde und Agrarökologie. „Doch in den letzten 15 Jahren ist ihre Anzahl sprunghaft angestiegen. Hunderte wissenschaftlicher Studien zeigen nun, dass dem Ökolandbau eine wichtige Rolle bei der Welternährung zukommen sollte.“ Zwar erzielten Biobauern in der Regel geringere Erträge, doch bei bestimmten Kulturpflanzen, Wachstumsbedingungen und Anbaumethoden könnten sie mit den Ernten der konventionellen Landwirte gut mithalten. Die von Reganold und Mitautor Jonathan Wachter analysierten Studien zeigen: „Unter Bedingungen wie extremer Trockenheit, die mit dem Klimawandel in vielen Gebieten zunehmen wird, erzielten Biobetriebe oft höhere Erträge als ihre konventionellen Kollegen, da die ökologisch bewirtschafteten Böden Wasser besser speichern konnten.“ Den Autoren zufolge hat der Ökolandbau viele Vorteile für die Umwelt. „Überblicksstudien haben gezeigt, dass ökologische Anbausysteme durchweg mehr Kohlenstoff im Boden speichern, eine bessere Bodenqualität aufweisen und seltener von Erosion betroffen sind als konventionelle Systeme.“ Zudem belasten sie Böden und Gewässer weniger und verursachen geringere Treibhausgasemissionen. Auch in finanzieller Hinsicht könnten Ökobauern generell mehr profitieren, da die Verbraucher bereit sind, höhere Preise für Bioprodukte zu bezahlen. „Würde der Preis für durch die Landwirtschaft verursachte, negative externe Effekte aufgeschlagen, wie Bodenerosion und Nitratauswaschung ins Grundwasser, wäre der Ökolandbau noch profitabler“, schreibt Reganold. Da bisher erst auf 1% der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche Ökolandbau betrieben werde und dieser in puncto Nachhaltigkeit besser abschneide, könne er noch weitaus mehr zur Welternährung beitragen. Doch um dieses Potenzial zu nutzen, müsse die Politik die Hürden für eine Ausweitung abbauen. Dazu zählen die Autoren die Kosten einer Betriebsumstellung und der fehlende Zugang zu Märkten, Krediten und Versicherungen, vor allem in ländlichen Gebieten und Entwicklungsländern. Doch Reganold und Wachter betonen auch, dass es keine Patentlösung gebe, um die Welt zu ernähren: „Es bedarf eher einer Mischung aus ökologischen und anderen innovativen Anbausystemen“, z.B. die Agroforstwirtschaft oder eine Kombination von Ackerbau und Tierhaltung, um künftig die Ernährung sicherzustellen und die Ökosysteme zu bewahren. (ab)
03.02.2016
Glyphosateinsatz verfünfzehnfacht sich seit Einführung von Gentechnik-Pflanzen

Glyphosat ist mittlerweile das am meisten verwendete Herbizid in der Geschichte: Ganze 8,6 Milliarden Kilogramm wurden seit 1974 versprüht, dem Jahr, in dem der US-Agrarriese Monsanto den Wirkstoff erstmals unter dem Markennamen Roundup vermarktete. Das zeigt eine neue Studie, die in der Februarausgabe des Fachmagazins „Environmental Sciences Europe” erschienen ist. Diese belegt eine dramatische Zunahme der eingesetzten Menge insbesondere seit der Einführung von Soja-, Mais- und Baumwollsorten, die mittels Gentechnik resistent gegen den Unkrautvernichter gemacht wurden. Studienautor Charles M. Benbrook wertete im Zuge einer Forschungsprofessur an der Washington State University Behördendaten aus. Sein Ergebnis: Der Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft hat seit 1996, als Gentechnik-Pflanzen erstmals in den USA angebaut wurden, um das 15-fache zugenommen. Setzten Landwirte rund um den Globus 1995 noch 51 Millionen Kilogramm des Wirkstoffs ein, waren es 2014 sage und schreibe 747 Millionen. In den USA stieg die Menge im gleichen Zeitraum um das Neunfache von 12,5 Millionen Kilogramm auf 113,4 Millionen. Vor allem in den letzten Jahren ist ein starker Anstieg zu verzeichnen. Rund 72% des seit 1974 weltweit angewandten Glyphosat wurde allein in den letzten zehn Jahren versprüht. Die im Jahr 2014 von Landwirten weltweit verwendete Menge würde ausreichen, um jeden Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche mit einem halben Kilogramm des Wirkstoffes einzudecken. Laut der Studie entfällt rund 56% der eingesetzten Glyphosatmenge auf Gentechnikpflanzen, obwohl diese weltweit nur auf etwa 13% der Ackerfläche wachsen. Neben der Ausweitung der Gentechnikanbaufläche nennt die Studie weitere Ursachen für den steigenden Glyphosateinsatz: Das Ackergift sei mit dem Auslaufen von Monsantos Patentschutz billiger geworden und Landwirte verzichteten zunehmend auf das Pflügen zur Unkrautbekämpfung. Durch das verstärkte Auftreten resistenter „Superunkräuter“ komme zudem häufiger Glyphosat zum Einsatz. „Die dramatische und schnelle Zunahme beim Gesamteinsatz von Glyphosat wird voraussichtlich eine Menge negativer Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit haben“, befürchtet Benbrook. Im März 2015 hatte die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation Glyphosat als „wahrscheinlich“ krebserregend für den Menschen eingestuft. Seither ist unter Wissenschaftlern und Behörden ein bitterer Streit über die Gefährlichkeit des Wirkstoffs entbrannt. Benbrook sieht hier noch weiteren Forschungsbedarf. (ab)
01.02.2016
FAO-Bericht: Seltene Nutztierrassen vom Aussterben bedroht

Viele selten gewordene Nutztierrassen sind vom Aussterben bedroht – dabei könnten ihre genetischen Eigenschaften in Zeiten des Klimawandels für die Welternährung enorm an Bedeutung gewinnen. Darauf macht die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in ihrem zweiten Bericht zum weltweiten Stand der tiergenetischen Ressourcen aufmerksam. Um den bestehenden Genpool zu bewahren und sicherzustellen, dass die Vielfalt seltener Nutztierrassen künftigen Generationen erhalten bleibt, seien verstärkte Anstrengungen nötig. Der FAO-Generaldirektor betonte im Vorwort, die genetische Vielfalt sei für die Widerstandsfähigkeit und die Anpassung an künftige Herausforderungen grundlegend. „Seit tausenden von Jahren haben domestizierte Tiere wie Schafe, Hühner und Kamele direkt zum Lebensunterhalt und zur Ernährungssicherheit von Millionen Menschen beigetragen. Dazu gehören auch die 70 Prozent der Armen in ländlichen Gebieten“, so da Silva. Weltweit sind 1.458 landwirtschaftlich genutzte Tierrassen vom Aussterben bedroht, das sind gut 17% aller Nutztierrassen. Aufgrund der schlechten Datenlage ist zudem bei fast 60% der Nutztierrassen unklar, wie es um ihren Erhaltungszustand bestellt ist. Als Gründe für die zunehmende Verringerung der genetischen Vielfalt nennt die FAO wahllose Kreuzungen, den wachsenden Einsatz nicht heimischer Tierarten, den Rückgang traditioneller Produktionsformen sowie die Vernachlässigung von Rassen, die nicht als leistungsfähig genug gelten. Viele Länder importieren genetisches Material für die Tierzucht, um etwa die Milchleistung zu steigern oder das Wachstum zu beschleunigen. Dadurch gingen wertvolle Merkmale verloren, wie die Eigenschaft bestimmter Tierrassen, hohe oder extrem niedrige Temperaturen zu ertragen oder mit wenig Wasser, minderwertigem Futter und großen Höhenlagen klarzukommen. Der Bericht führt das brasilianische Pantaneiro-Rind an, eine Rasse, die gegen verschiedene durch Parasiten verursachte Krankheiten resistent ist. Von der Rinderart, die in Brasilien einst allgegenwärtig war, sind nur noch 500 reinrassige Tiere übrig, wodurch ihr Fortbestand gefährdet ist. Doch es gebe auch Fortschritte zu vermelden, da immer mehr Staaten und Tierzüchter weltweit den Wert der genetischen Vielfalt von Nutztieren erkannt hätten und Genbanken eingerichtet wurden, so die FAO. Ein Beispiel für die erfolgreiche Wiederbelebung einer vom Aussterben bedrohten Nutztierrasse ist das ungarische Mangalica-Schwein, auch Wollschwein genannt. Ende der 1980er Jahre gab es nur noch 200 Exemplare, da andere Schweinerassen, die mehr Fleisch mit weniger Fett lieferten, das Wollschwein verdrängt hatten. Doch dank der Bemühungen mehrerer Züchter nimmt ihre Zahl nun wieder zu. (ab)
27.01.2016
Forscher fordern Bindung von Agrarzahlungen an ökologische Leistungen

Ökosystemleistungen sollten stärker in Entscheidungen über die Nutzung und Entwicklung ländlicher Räume einfließen und Zahlungen der Agrarpolitik gezielter an die Bereitstellung von Leistungen für die Gesellschaft geknüpft werden. Das fordert der am 20. Januar erschienene Fachbericht „Naturkapital Deutschland – TEEB DE“, der die Dienste der Natur aus wirtschaftlicher Sicht bewertet und untersucht, wie die Multifunktionalität ländlicher Räume bewahrt und gefördert werden kann. „Eine Investition in die Natur ist eine Investition in die Zukunft“, betonte Studienleiter Prof. Dr. Bernd Hansjürgens vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). „Verlieren wir wichtige Ökosystemleistungen, führt das zu hohen volkswirtschaftlichen Kosten.“ Denn eine nur auf Produktivität ausgerichtete Landwirtschaft führe zu Emissionen von Klimagasen und einer übermäßigen Belastung der Gewässer und Meere. Multifunktionale Agrarlandschaften dagegen reduzieren Belastungen und erhalten das Naturkapital, teilte das UFZ mit. Der Bericht untersucht sowohl den Nutzen, der durch den Schutz, die nachhaltige Nutzung oder die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme entsteht, als auch die Kosten, die ihr Verlust verursachen würde. Professor Hansjürgens nennt ein Beispiel: „Der fortschreitende Grünlandumbruch in Deutschland führt beispielsweise pro Hektar und Jahr zu gesellschaftlichen Folgekosten zwischen 440 und 3.000 Euro. Den Grünlandverlust zu stoppen ist nicht nur eine naturschutzfachliche Aufgabe, sondern vor allem auch eine volkswirtschaftlich sinnvolle Investition. Artenreiches Grünland trägt erheblich zur Erhaltung unserer biologischen Vielfalt bei.“ Auch den volkswirtschaftlichen Nutzen von Gewässerrandstreifen in Niedersachsen nahmen die Forscher genauer unter die Lupe und stellten fest, dass die ökonomisch bezifferbaren positiven Auswirkungen dieser Maßnahme für den Boden- und Hochwasserschutz, das Landschaftsbild oder die biologische Vielfalt die Kosten um das 1,8-fache übersteigen. Doch die derzeitige Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU setze noch keine ausreichenden Anreize für die Erbringung ökologischer Leistungen und den Schutz der Natur. „Wir unterstützen daher die Forderung, die Direktzahlungen in der ersten Säule der Agrarpolitik als rein flächenbezogene Subventionierung abzuschaffen und dafür verstärkt Mittel in der zweiten Säule der Agrarumweltpolitik (Agrarumweltmaßnahmen) als ‚echte’ Honorierung zusätzlicher öffentlicher Leistungen der Landwirtschaft effizient einzusetzen“, so Berichtsleiterin Prof. Dr. Christina von Haaren von der Leibniz Universität Hannover. (ab)
25.01.2016
Im Urin: Umweltbundesamt warnt vor steigender Glyphosatbelastung der Bevölkerung

Das Umweltbundesamt warnt vor einer zunehmenden Belastung der Bevölkerung mit dem Unkrautvernichter Glyphosat. Eine am 21. Januar veröffentlichte Landzeitstudie hatte eine deutliche Anreicherung von Glyphosat im Urin der Testpersonen festgestellt. Um die Belastung mit Glyphosat zu ermitteln, hatte die Behörde 400 archivierte Urinproben von Studentinnen und Studenten aus der Umweltprobenbank des Bundes analysieren lassen. Das Ergebnis: Während das Herbizid 2001 lediglich im Urin von 10% der Teilnehmer nachweisbar war, waren im Jahr 2015 bereits 40% der Proben belastet. 2013 wurde Glyphosat sogar bei knapp 60% der Testgruppe gefunden. Zwar liege der höchste gemessene Wert um den Faktor 1.000 niedriger als die EU-Lebensmittelbehörde EFSA für gefährlich hält. Doch im Gegensatz zur EFSA hatte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der WHO im März 2015 Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend für den Menschen“ eingestuft. „Folgt man der IARC-Bewertung, kann derzeit keine Entwarnung gegeben werden. Insbesondere der in den Proben beobachtete Anstieg wäre dann als besorgniserregend einzustufen“, schreibt das Umweltbundesamt. UBA-Präsidentin Maria Krautzberger sieht weiteren Forschungsbedarf: „Wir müssen die Datenlage zur Belastung beim Menschen verbessern. Insbesondere bei Kindern wissen wir bisher kaum etwas. Dazu läuft im UBA bereits eine Studie. Wir sollten Glyphosat auch nicht isoliert betrachten, sondern die eingesetzten Produkte umfassender untersuchen. Heißt: Glyphosat mitsamt der anderen Stoffe bewerten, die zugesetzt werden, damit es auf dem Acker überhaupt wirkt.“ Dass nicht nur Landwirte mit Glyphosat belastet sind, hatte schon 2013 der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland getestet: In einer stichprobenartigen europaweiten Untersuchung waren Glyphosat-Rückstände im Urin von Großstädtern in 18 Ländern nachgewiesen worden, die Proben von 70% der Briten, Polen und Deutschen fielen positiv aus. Glyphosat ist das meistverkaufte Pestizid in Deutschland. 2014 wurden nach Angaben der Bundesregierung rund 5330 Tonnen Glyphosat an Landwirte und etwa 95 Tonnen an nicht-berufliche Verwender abgegeben. Das Umweltbundesamt plädiert nun für eine deutliche Verringerung des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft – nicht nur aufgrund möglicher Gefahren für die menschliche Gesundheit: „Der Pflanzenschutz mit Chemie ist einer der Hauptgründe für den Verlust der biologischen Vielfalt auf unseren Äckern. Dass es anders geht zeigt der Ökolandbau, der weitgehend auf Pflanzenschutzmittel verzichtet“, so Krautzberger. Denn die Ackergifte wirken sich nicht nur auf die Schädlinge aus: Der massive Einsatz von Glyphosat und anderen Herbiziden vernichte auch Ackerkräuter und Insekten und beraube so viele Tiere ihrer Nahrungsgrundlage. Das Umweltbundesamt will zudem eine Debatte darüber anstoßen, wer für die Kosten aufkomme, die der chemische Pflanzenschutz durch Schäden an Umwelt und Gesundheit anrichte. Bislang sei das vor allem der Steuerzahler, so das UBA. Daher sei eine Abgabe auf Pflanzenschutzmittel erwägenswert, denn sie würde das Verursacherprinzip einführen. (ab)
20.01.2016
EPA widerruft Monsanto-Patent auf konventionell gezüchtete Melone

Keine Melone für Monsanto: Das Europäische Patentamt (EPA) hat ein Patent des US-Agrarriesen auf eine konventionell gezüchtete Melone widerrufen. Mehrere Organisationen hatten gegen das Patent EP 1962578 Einspruch eingelegt. Monsanto meldete damit Ansprüche auf eine Melone an, die eine ohne den Einsatz von Gentechnik gezüchtete natürliche Resistenz gegen ein bestimmtes Virus aufweist, das zum Vergilben der Pflanzen führt und so die Erträge mindert. In einer öffentlichen Verhandlung am 20. Januar wurde das Patent nun aus technischen Gründen widerrufen. Das EPA begründete die Entscheidung damit, dass Monsanto nicht präzise genau beschrieben habe, wie man die Melonen züchten könne. Diese Nacharbeitbarkeit sei aber die Voraussetzung für ein Patent. Monsanto hatte das Patent im Jahr 2006 angemeldet und 2011 erhalten. Das Resistenzgen wurde allerdings zum ersten Mal in einer 1961 katalogisierten indischen Melonenpflanze gefunden, die seit 1966 öffentlich zugänglich ist. „Monsantos Patent auf Melonen ist ein klarer Fall von Biopiraterie. Die natürliche Resistenz hat nicht Monsanto erfunden, sie wurde vielmehr in indischen Melonen entdeckt. Jetzt behauptet Monsanto, es sei eine Erfindung, andere Melonen mit dieser Resistenz zu züchten. Doch wenn jemand etwas kopiert, ist das noch lange keine Erfindung“, so Francois Meienberg von der Erklärung von Bern, die gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Bund Naturschutz in Bayern e.V., Gesellschaft für Ökologische Forschung, Greenpeace, Kein Patent auf Leben!, dem Verband Katholisches Landvolk und der Zukunftsstiftung Landwirtschaft den Einspruch eingelegt hatte. Doch das Patent ist nicht nur eine Verletzung des indischen Gesetzes zum Schutz der biologischen Vielfalt, wie auch die indische Regierung vor der Anhörung dem EPA per Brief mitteilte, sondern auch europäischer Patentgesetze: „Das Patent basierte auf konventioneller Züchtung und beanspruchte Pflanzensorten. Beides darf laut europäischer Patentgesetze nicht patentiert werden. Die Erteilung des Patentes war ein klarer Rechtsbruch“, sagt Christoph Then für die internationale Koalition Keine Patente auf Saatgut!. Doch das sieht das EPA anders. Die Große Beschwerdekammer entschied im März 2015 in einer umstrittenen Grundsatzentscheidung zu den Präzedenz-Patenten auf Tomate und Brokkoli, dass grundsätzlich „biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen“ nicht patentierbar sind, allerdings jedoch die daraus entstandenen Pflanzen und Früchte. Erst kürzlich erteilte die Behörde dem Schweizer Agrarriesen Syngenta Patente auf eine samenlose Paprika und eine Tomate mit besonders vielen gesundheitsförderlichen Flavonolen. Womöglich ist im Melonenfall daher das letzte Wort noch nicht gesprochen, wenn Monsanto Beschwerde einlegt. „Der Widerruf des Patents ist ein wichtiger Erfolg, aber das generelle Problem kann nicht durch Einsprüche am EPA gelöst werden. Die Politik muss dafür sorgen, dass Gesetze korrekt angewendet und Verbote nicht ausgehebelt werden. In Deutschland liegt die Verantwortung bei Justizminister Heiko Maas“, betont Christoph Then. (ab)